Kirstin Breitenfellner liest David Hoffmanns einüben ins aussterben
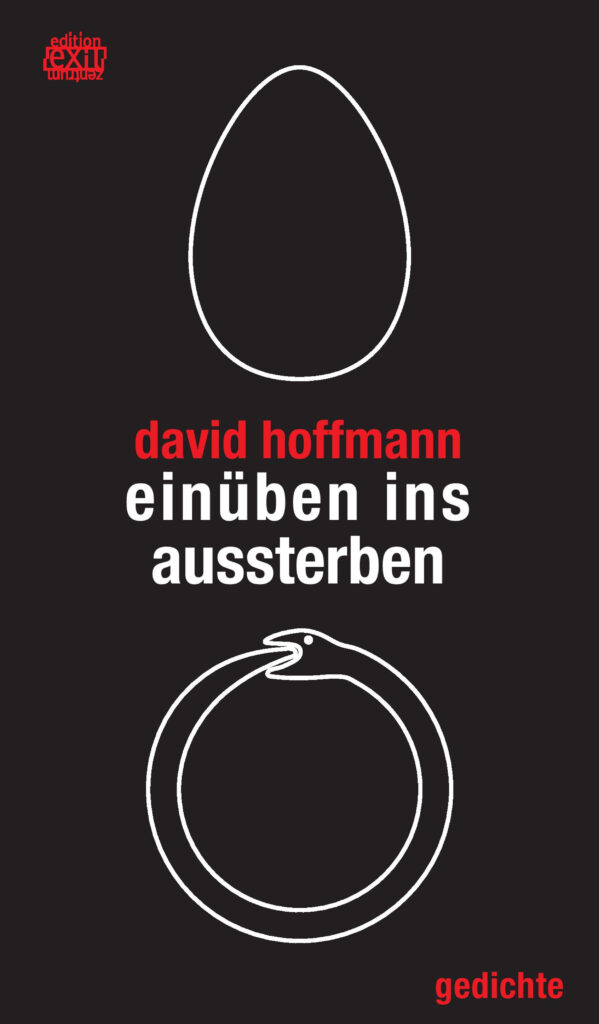
Gedichtbände mit apokalyptischer Schlagseite schlägt man derzeit des Öfteren auf. Bei David Hoffmanns Debütband einüben ins aussterben vermutet man eine solche vom Titel her, wird dann aber im Inneren eines, ja, sagen wir Besseren belehrt. Denn Hoffmann hält hier nicht der ganzen Menschheit den sprichwörtlichen Spiegel vor, um sie mit (ökologisch-moralischen) Vorwürfen zu konfrontieren, sondern steigt tief in seine eigene Geschichte hinab.
Cover © edition exil
Den Auftakt des in drei Kapitel mit den Titeln „ein grundriss“, „ins leere“ und „aus uns“ unterteilten Bandes machen zwei zentriert gesetzte Gedichte. Das erste stellt eine Selbstvergewisserung des Ichs dar, das ja in Gedichtbänden nicht immer einen festen Stand hat. Hier besitzt es zumindest ein Gehäuse aus einer Wohnung, die von „Erde“, also Natur, stabilisiert wird.
es gibt ein ich das hat zimmer küche bad und einen raum an den ringsum erde presst
Im zweiten zentriert gesetzten, etwas längeren Text „saum der ruhe“, begibt sich der Autor in die Räume der Kindheit zurück, in denen, wie wir in Folge lernen werden, sich das Ich noch nicht konstituiert hatte, noch auf der Suche war. Glücklich war diese Kindheit allem Anschein nach nicht, der Vater, hier „erzeuger“ genannt, ist tot, und das Kind hält sich fest an „einem moment des zuvor“, an Momenten, „an deren saum ich ruhe suche“.
Räume der Kindheit
Räume haben es David Hoffmann angetan. Wie eine Nachbemerkung des Autors (in konsequent durchgehaltener Kleinschreibung) verrät, fußt das erste Kapitel „grundriss“ auf Gaston Bachelards „poetik des raumes“ als der „festlegung eines kindheitshauses als werkzeug der psychoanalyse“, die Bachelard Topophilie nennt. Hoffmann besteht darauf, mit seinem „lyrikessay“ ein Gegenstück, die „topophobie“, zu entwerfen. Dies sei, meint er mit augenzwinkerndem Understatement, „oberflächlichst“ von Gilles Deleuzes und Félix Guattaris „Anti-Ödipus“ inspiriert. „das psychoanalytische schreiten durch die erinnerungsräume wird zum schizo-analytischen fallen/stolpern. der auflösung dieser fiktiven dualität liegt meine beschäftigung mit dichotomien kritisierenden theorien zugrunde“ – für die wiederum exemplarisch die Wissenschaftshistorikerin und Feministin Donna Haraway genannt wird.
So weit, so theoretisch. David Hoffmann, 1985 in Oberwart geboren, aufgewachsen in Österreich und Ungarn, übersetzt aus dem Ungarischen und gewann 2022 den Exil-Lyrikpreis. Er besitzt einen Master der Philosophie an der Universität Wien, studierte Theater-, Film- und Medienwissenschaften und war Redakteur und Mitherausgeber der Fachzeitschrift „SYN, Magazin für Theater-, Film und Medienwissenschaften“. Glücklicherweise merkt man den Gedichten von dieser theoretischen Unterlage nichts an, ja, man kann sie lesen, ohne von dieser zu wissen. Das zeugt von einer dichterischen Reife, wenn nicht gar Souveränität.
Zurück zur „topophilie“: In den nun folgenden Gedichten durchschreitet Hoffmann also die Räume der Kindheit, beginnend mit einem Haus, das ein Dach trägt wie ein Toupet, über einen Baum, aus dem ein Vogelnest fällt, einen Garten, in dem Monster wohnen. Mit der älteren Schwester gibt es ein Gerangel in der Badewanne und einen schließmuskelbedingten Unfall, das Dreirad zu Weihnachten verschafft Freude, und im Bett liegt der tote Vater und ist dann plötzlich doch nicht tot, er hatte alles nur gespielt. Ein böser Scherz? Ängste, magische Momente und die Suche nach Geborgenheit sind hier leichtfüßig festgehalten. Einmal stellt sich das lyrische Ich dabei vor, das Junge der Hündin zu sein.
Enger wird es im nächsten Abschnitt, „topophobie“, nicht nur typografisch, in engem Blocksatz. Durch „häuser eng an eng in höhen gezogen“ geht es zu dem Haus zurück, „das frühe lebensjahre forderte“. Das Haus ist „blind und unbewegt“ und hat sein neckisches Toupet verloren. Aber die Hündin tritt auch hier wieder auf. Das lyrische Ich steigt im Traum bzw. im Halbbewusstsein nach dem Aufwachen in einen Schacht: die Vergangenheit.
(…) meine stimme zieht einen kreis und singt // summt nächte weg findet ruhe findet leere darin ein raum sich eröffnet fein behaarter spinnenarme ein netz kreisrund aus lied wie licht (…)
Hoffmanns Gedichte sind weder anklagend noch bitter, sondern tastend, lakonisch und atmosphärisch. Als Musiker – Hoffmann ist Texter und Falsettsänger der Literaturpunkband Smashed To Pieces – bringt er Musikalität in sein dichterisches Denken. Seine Gedichte, die ohne Interpunktion und ohne Reim auskommen, klingen laut gelesen wie Lieder, wie Balladen an das Unzulängliche, mit dem sich der dem Haus der Kindheit Entwachsene abzufinden versucht. Dabei arbeitet Hoffmann gerne mit Variationen, sowohl sprachlicher als motivischer Natur. Wörter und Zeilen wiederholen sich, werden enggeführt, aufgedröselt und umgebaut. Variantenreich ist auch der Satz: zentriert, rechtsbündig, linksbündig, im Blocksatz, einmal dreispaltig – ein Gedicht besteht gar nur aus den Zeichen x und dem Unterstrich. Trotzdem zieht sich ein erzählerischer Faden durch den Band.
Städtische Balladen
Das zweite Kapitel „ins leere“ eröffnet mit dem titelgegebenden Gedicht „einüben ins aussterben“. In dieser urbanen Ballade hält zu Beginn ein Zug an, und das lyrische Ich, das sich selbst als Du anspricht, hält nach einem „suizidenten“ Ausschau. Von der Großstadtumgebung zeugen unter anderem ein Stiegenhaus, in dem das ich an Crack Rauchenden vorbeigeht oder der Geruch des Bettlers, dem das lyrische Ich einen Moment zu lange „nachschmeckt“. Gemeinschaftsgefühl kommt im Pub auf:
(…) ein pub, sieben pints wir teilen uns einen joint und er erzählt, wie seine freunde marokkanische haschbonbons verpacken und schmuggeln (…) ein pub, sieben pints sie meinten: lieber sterben als nichts also: fünf flüge, ein haus wenn sie dich kriegen, bist du raus
Das Leben in der Stadt bedeutet Getöse von Maschinen und Begegnungen mit Unbekannten, Frühstücksweckerln und Coffee-to-go, und zwischendurch wird es auch todtraurig. Dann schlägt das lyrische Ich systematisch, wie in dem Gedicht „staub:kante“ seinen Kopf auf die Tischkante. „sei traurig“ heißt ein Gedicht, das man als eine paradoxe Intervention lesen könnte, als ein Bannen der Traurigkeit durch ihr Weitertreiben ins Äußerste:
drücke deinen kopf ins kissen vergiss alles lass den verlust dich verschlingen verliere dich darin vermeide zuneigung sie könnte dich von trauer und verlust ablenken sei unglücklich freu dich nicht und kauf dir ein mohneis mit schlag keinesfalls der tröstung wegen sondern um fett und hässlich zu werden folge dabei absurden und willkürlichen hässlichkeitsidealen (…)
Ein zartes Wir
Das letzte Kapitel „aus uns“ wagt zarte Hommagen an ein Wir. Ein vermutlicher Nachruf mit der Widmung „für brücki“ beginnt zärtlich: „wir pflücken unsere augäpfel / sammeln sie im brustkorb /öffnen ihn mit schlüsselbein“ und endet ebenso: „bis unsere schulterblätter welken / fallen / wir / eingehüllt in trommelfell / in achselhöhlen überwintern“. Am Schluss stehen gar „sechs variationen über die liebe aus phobien heraus“: „akrophilia“, „trypophilia“, „tetraphilia“, „enochlophilia“, „thanatophilia“ und „dysmorphophilia“. (Die aus dem Altgriechischen stammenden Fremdwörter werden ebenfalls im „anhang“ erläutert.)
Abschließend sei noch ein ungekürzter Text zitiert, um sich selbst ein Bild von dieser stillschweigend durchdachten, tief musikalischen, wahrhaftigen und verhalten hoffnungsvollen Lyrik zu machen.
licht ich suche züge wie sie sich winden vorbeiziehen // vertiefen // hervorspringen hinter ecken und kanten könntest du stehen dich bewegen zwischen bruchstücken die dein fehlen ergeben außerhalb dieser tiefen schächte unpersönlichen gewimmels labyrinthischen betons von leuchtwürmern durchzogener dunkelheit wirst du mich finden um an der oberfläche dich auf mich zu legen so als ob dir etwas an mir gelegen
David Hoffmann: einüben ins aussterben. Gedichte. edition exil, Wien, 2025. 121 Seiten. Euro 14,–




