Lukas Meschik liest Armin Thurnhers Sieben Flüsse
Den 1949 in Bregenz geborenen Armin Thurnher kennt man gemeinhin als Mitbegründer und Herausgeber der Wochenzeitung Falter sowie als spitzzüngigen Kommentator des (österreichischen) Weltgeschehens. In seinen täglichen Einlassungen vergreift er sich manchmal im Ton, etwa wenn er dem frisch verstorbenen Sektionschef Christian Pilnacek bereits am Tag nach dessen Tod mal eben ins Jenseits ausrichtet, dass dieser „arrogant bis zum Abwinken“ gewesen sei, was eine Beschwerde beim Presserat nach sich zog.
Mit Lyrik hat all das überhaupt nichts zu tun, allerdings handelt es sich bei Sieben Flüsse eben um einen Gedichtband von jemandem, den man nicht als Lyriker abgespeichert hat, sondern als medial präsenten und durchaus streitbaren politischen Beobachter. Bekennender Lyrikleser und -liebhaber war Thurnher immer schon.
Vielleicht als Erholung vom politischen Tagesgeschehen entstand diese Sammlung von eigener, sehr gelassener, oft nachdenklicher Naturlyrik, die das Werden und Vergehen durch die Jahreszeiten mitstenographiert. Man kann beim Lesen die Autorenschaft nicht ausblenden – tut allerdings gut daran, diese Gedichte völlig unbefangen und entspannt auf sich wirken zu lassen. Sie dürfen und sollen für sich stehen – und eröffnen gerade deswegen eine neue Perspektive auf den umtriebigen Publizisten Thurnher.
GRÜNER KOMET Blickte zum Himmel. Suchte den grünen Kometen. Staunte über den blinkenden Nordstern. Sein Sog zog die Wolken, Triebwerk im Dunkeln voll heller Flecken, in denen kalte Sterne blinkten, aber kein grüner Komet; Amateure fotografierten ihn, sagt man. Für mich heißt es warten. In fünfzigtausend Jahren kommt er wieder, der grüne Komet
Blick in den Himmel
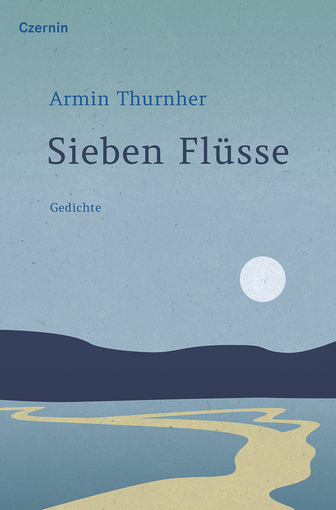
Fast alle Gedichte sind im ersten Teil des Bandes versammelt, der den Namen „Landlebig“ trägt und sich in sechs Abschnitte gliedert: „Lebig“, „Frühling“, „Sommer“, „Herbst“, „Winter“ und „Weiter“. Erst im zweiten, titelgebenden Teil „Sieben Flüsse“, in dem Thurnher auf wenigen dicht beschriebenen Seiten eindrücklich seine Lebensflüsse nachzeichnet, begegnen wir besagten Gewässern.
Cover © Czernin Verlag
Oft ist sein Blick in den Himmel gerichtet, und so werden Vögel zu wiederkehrenden Begleitern durch den Band. Ob Falke (S. 12, S. 16, S. 32, S. 39, S. 102), Habicht (S. 12, S. 18) oder Bussard (S. 39, S. 49, S. 97, S. 102), wir lernen sie kennen und schätzen.
HABICHT Von der Schneeräumstange erhob sich der mächtige Habicht und wies mir seine flauschige Unterhose Die Sonne füllte den Rückspiegel mit Blut. In meinem Körper kreiste die Tetanusimpfung. Im Radio spielte Keith Jarrett etwas möglichst Trauriges. (…)
Der Blick auf diese Tierfreunde ist sanft, gern verspielt. Die Natur und ihre Bewohner treten nie als bedrohlich oder auch nur roh in Erscheinung, der Überlebenskampf im Tierreich bleibt meistens vornehm ausgeblendet. Gefahr droht höchstens vom Menschen, etwa wenn das lyrische Ich sich mit dem Auto einem in der Sonne rastenden Mäusebussard nähert und lakonisch feststellt: „Er sitzt über mir. / Ich fahre unter ihm durch. / Zwei Todesarten / entgehen einander.“
Japankirsche und Löwenzahn
Auch Pflanzen wie Rotdorn und Weißdorn, Forsythie und Flieder, Japankirsche und Löwenzahn haben ihren prominenten Auftritt, werden durch die sich verändernden Temperaturen und Zustände begleitet. Menschen trifft man hier selten, und wenn, dann eher als Störenfriede, denen der Sinn für die Details um sie herum fehlt – sie gehen einem beim Lesen auch nicht ab. Mit liebevoll tadelndem Blick schildert Thurnher seine Artgenossen, die „erhöht in den SUVs“ sitzen oder im Zug ungebührlich laut telefonieren.
Nicht erst seit Jean Paul Sartre wissen wir, dass die anderen die Hölle sind, und so tut es wirklich gut, über hundert Seiten lang fast gänzlich auf sie zu verzichten. Mit feiner Beobachtungsgabe weist Thurnher uns auf Verhaltensweisen unserer tierischen Mitbewohner hin, die einem im gehetzten Alltagstakt entgehen, hin und wieder nimmt er uns mit in seine reichhaltige Erinnerungslandschaft.
DIE ERDE Die Winteräpfel röten sich früh. Der Zwetschkenbaum, im Frühjahr gepflanzt, ist verdorrt. Beim Erwachen spüre ich täglich das Zittern der Erde an meinen Rippen.
Gefundene und erfundene Wörter
In Sieben Flüsse wendet Thurnher seine altbekannte Fabulierlust und Formulierkunst abseits des journalistischen oder essayistischen Parketts an, was ihm gut zu Gesicht steht. In seltenen Momenten lässt er sich – einnehmend augenzwinkernd – zu einem Reim hinreißen.
Was auf den ersten Blick irritiert, ist seine Interpretation eines Haiku, jedenfalls was die Silbenzählung angeht: 4-7-6, 7-5-7, 5-7-4, 5-8-5, 5-7-5 – da ist für jeden etwas dabei. Zwar „muss“ ein deutschsprachiges Haiku nicht zwangsläufig aus 17 Silben mit der Aufteilung 5-7-5 bestehen, aber bei der Entscheidung gegen Formstrenge und für eine beliebige Silbenzahl (17, 19, 16, 18, 17) wäre man neugierig auf eine Begründung. Der subtile Regelbruch geschieht bewusst, und erlaubt ist sowieso, was gefällt. Auf der inhaltlichen Ebene bleibt Thurnher dem klassischen Haiku treu und zeichnet Stillleben einer fragilen Natur.
ZWEI HAIKU Mond lockt den Bock am Pflock, eine Pfingstrose regnet Silberblüten * Pfingstrose blüht in Kälte, blutroter Tropfen vom Stich in ein stolzes Herz.
Die Vorgänge des Tierreichs und der Natur fordern selten zu Bewertung heraus, dafür umso mehr zur originellen Beschreibung. Thurnher findet Wörter für die winzigsten Details, und wo es noch keine gibt, da erfindet er sie. Sein lyrischer Ton – ein milder, uneitel erhabener, dabei stets selbstironischer – schafft eine wärmende Geborgenheit, der man sich gern anvertraut. Thurnher ist erst spät als Lyriker in Erscheinung getreten, hätte das aber ruhig früher tun dürfen.
(…) Ich warte seit Jahren auf diese Sekunde und habe auch heuer sie glanzvoll verpasst.
Armin Thurnher: Sieben Flüsse. Gedichte. Czernin Verlag, Wien, 2025. 120 Seiten. Euro 22,–




