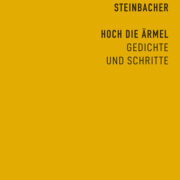Petra Ganglbauer liest Michael Donhausers Unter dem Nussbaum. Lyrik und Prosa 1986 bis 2023
Die Gedichte und Kurzprosa Michael Donhausers sind akribische Studien. Für die Leserin scheint es beinahe unmöglich, sich dem Tiefgang, dem der Dichter in seinem Werk über die Jahre konsequent nachgeht, zu entziehen. Donhauser generiert nicht nur aus der Sprache, er webt und flicht, er spinnt Text. Protokollarisch auch, jedoch nie trocken, weil beseelt, atmend durch die immerwährende Bewegtheit der Natur, zeigen sich Landschaften, Pflanzenwelten oder Tiere.
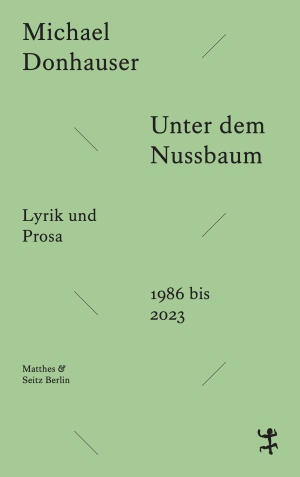
Die Motive wiederholen sich mitunter, als nähere sich der Autor – analog zum Jahreskreis –wieder und wieder den gleichen Phänomenen. Dafür tut er dies mit einer Nachdrücklichkeit, die ihresgleichen sucht.
Cover © Matthes & Seitz Berlin
Verzicht auf den urteilenden Blick
Der Sammelband des 1956 in Vaduz/Liechtenstein geborenen Autors versammelt Gedichte und Prosa von 1986 bis 2023 und ist in mehrere Kapitel aufgeteilt. Bereits im ersten Text, der der ersten Publikation Donhausers im Jahr 1986 mit dem Titel DER HOLUNDER entnommen ist, wird evident, dass sich der Mensch selbst, das menschliche Subjekt also, aus den Schilderungen immer wieder zurückzieht, die anthropologische Quelle der konzisen Betrachtungsweisen sohin nicht mehr nachvollziehbar scheint, weil das, was existiert, einfach ist, jenseits übertriebener Filtermechanismen.
Die Amsel Ein Innehalten im gelben Schnabel, in den Krallen ein Verharren, zarter als fest. Ein Hören nach Außen und Innen im Auge (…)
Der unbestimmte Artikel etwa ermöglicht, dass auf einen richtenden, objektbezogenen Blick weitgehend verzichtet und das Geschehen neutral geschildert wird. Zudem ermöglichen die Personifikationen, dass es die Natur selbst ist, die wirkt.„Viele Bisse und Küsse, ein Schlürfen und Schmatzen, sie duftet und dürstet danach“, heißt es in „DIE QUITTE“.
Die Sprache und der Blick nehmen sich in allen Texten zurück, zart und ohne zu urteilen. Poetische Definitionen sind das, die jedoch durch ihre Dichte, ihre Liebe zum Detail, ihre Genauigkeit mitunter wie Gemälde anmuten, sich auch aufgrund der Plastizität und Chromatik sowie der präzisen Darstellung Bildern angleichen.
Verlangsamung
Lange Sätze, mit unzähligen Beistrichen finden sich in der Prosa, eine Methode, die retardierend wirkt, beruhigend, die die Konzentration auf das Erzählte stärkt. Zudem findet sich da eine stille Verkettung der Dinge, die einen nicht loslässt. So etwa in dem Text „DIE GÄRTEN“, in dem sich das Ich auf die Spuren eines Zitats von Annette von Droste-Hülshoff begibt:
„Die Gärten, waren sie das Bett, worauf ich ruhte wie im Grase, wie unter dem Blattwerk, wo ich dösend und hell- wach in einem ein Nachtleben führte, ein versponnenes; ich sah die Sonne als Sterne durch die Blätter blitzen, der Kies lag nächtlich im reglosen Licht, ich nannte das Licht still, und es war Stille, welche Stunde für Stunde von Glockenschlägen durchkreuzt die Gärten füllte wie eine Dun- kelheit, ich durchwachte die Nachmittage.“
Das visuelle Element
Michael Donhauser nimmt sich für seine Übersetzungen der beseelten Natur auch den nötigen Raum. Das Weiß des Papiers spricht in vielen Texten mit und tut dies äußerst sachte, etwa in den Kapiteln „DREIZEILER“ oder „SARGANSERLAND“.
Schließlich greift Donhauser auch auf einen Begriff aus der bildenden Kunst zurück, wenn er „17 DYPTICHEN IN PROSA“ verfasst, zweiteilige Text-Werke sozusagen. Diese Prosa gibt sich dynamischer und enthält auch den subjektiv-menschlichen Gestus. Die Texte fassen hinein ins Leben, ins Konkrete, Elementare und kommen einer Rückbindung an den Alltag gleich. Sie sind nicht vergleichbar mit jenen leisen Sequenzen zu Beginn des Buchs, die sich mehr als Studien denn als Erzähltes darstellen.
Einen weiteren Zugang zu Donhausers Gesamtwerk eröffnen die „MAIENFELDER ELEGIEN“, über denen naturgemäß eine Melancholie schwebt, die bis in die kleinsten Szenen sickert.
„die Dohlen vom Berg herunter ins Dorf, wo sie saßen auf dem First der Dächer, doch umsonst reihte sich Bild so an Bild zu einer Erzählung, denn einsam blieb und hell das Plätschern der Brunnen, wie verlassen lagen die Plätze, und es duftete die Kälte nach Pferden – ich hörte das Aufsetzen der…“
Textil
Insistierend, repetierend wiederum „DIE ELSTER“. In diesem Kurzprosastück wird wieder das Spinnen und Weben, die textile Qualität evident, jedoch erhöht sich hier verglichen mit den eingangs erwähnten Sequenzen die Geschwindigkeit, mit der die Sprache dem Naturgeschehen und sich selbst näher zu kommen sucht, denn Donhauser spiegelt mit schnellerem Atem Landschaft und Sprache, Stille und Schnee. In drei Anläufen nähert sich der Autor einem Bild aus Landschaft. „Noch einmal: die Elster“. „DIE SCHÖNSTEN LIEDER“, ein weiteres Kapitel, zeigt sich anmutig und verklärend und kommt der ursächlichen Nähe von Lyra und Lyrik sehr nahe.
Formal ist diese Zusammenschau weit gespannt, von Sonetten über Haikus zu Fugen oder Elegien. Bezeichnend ist Donhausers konsequente Hinwendung zu Metrik und Rhythmus.
Das Buch gibt einen genauen Einblick in die in der österreichischen Literaturlandschaft einmalige Wahrnehmung des Dichters und erinnert nachdrücklich an die traditionell enge Verbindung zwischen Lyrik und Naturgeschehen.
Michael Donhauser: Unter dem, Nussbaum. Lyrik und Prosa 1986 bis 2023. Matthes & Seitz. 508 Seiten. Euro 38,–