Klaus Ebner liest Axel Karners popanz
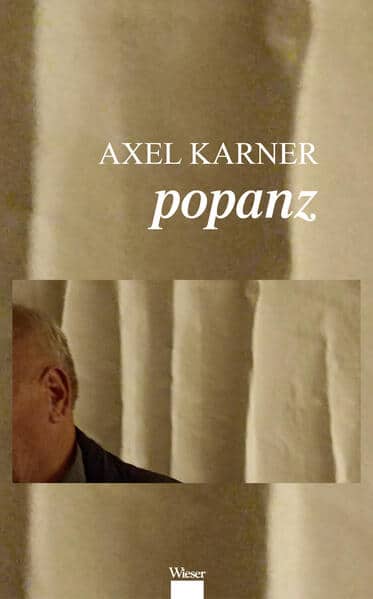
Axel Karner legt mit popanz einen weiteren Lyrikband vor, der in seinem Stammverlag, dem Klagenfurter Wieser Verlag, erschien. Popanze sind Puppen oder andere künstliche Gestalten, die beeindrucken, vielleicht auch einschüchtern oder Furcht verbreiten sollen. Karners Popanze beschreiben Figuren oder Personentypen: Menschengestalten, die es in sich haben und der Betitelung Popanz allemal gerecht werden, weil sie eine Reihe fragwürdiger und nicht eben angenehmer Eigenschaften in sich vereinen.
Cover © Wieser Verlag
Folglich präsentieren sich die Gedichte in der vom Autor gewohnten unverblümten Sprachgewalt. Axel Karner wurde 1955 in Zlan in Kärnten geboren. Er studierte evangelische Theologie, Theaterwissenschaft, Psychologie und Religionspädagogik. In Wien war er bis zu seiner Pensionierung als Lehrer für evangelische Religion, darstellendes Spiel und soziales Lernen tätig. Er schreibt Lyrik und Kriminal-Kurzgeschichten, und zwar in Schriftsprache und im Kärntner Dialekt. Bereits 1979 erhielt er ein Literaturförderstipendium des Landes Kärnten, und die ersten Buchpublikationen erschienen Anfang der 1990er Jahre.
Die meisten Gedichte des vorliegenden Bandes drehen sich um „Mannsbilder“, wie auch die jeweiligen Titel verraten – nur die Köchin, die Poetin und eine Spinne (!) fallen aus diesem Rahmen. Was ist nun Charakter, was ist Lebensstil, wie gehen diese „Typen“, denn solche sind sie im engsten Sinne des Wortes, eigentlich mit ihrem Leben um, wie präsentieren sie sich ihrer Umwelt?
Die beschriebenen Figuren sind zumeist keine besonders liebenswerten Gestalten. Sogar, wenn manch Titel eine nette Person vermuten lässt, zeigen die Verse schonungslos auch deren Schattenseiten auf. Axel Karner nimmt sich in gewohnter Weise kein Blatt vor den Mund, und da geht es schon mal derb und heftig zu. Dass gleich das zweite Gedicht des Buches den Titel „arschloch“ trägt, hat mich doch etwas überrascht. Der Text dazu lautet so:
was bist auch denunziant schnüffelst vier nächt bis dirs einbläst das ist bekannt mit haut und haar der schwindel vom fenster flutscht hörs martern das herzchen bürschlein weils wiederkehrt
Mit spitzer Feder wird Popanz um Popanz gezeichnet. Beim Lesen höre ich eine eindringliche Stimme, die – zum erhobenen Zeigefinger – jedes einzelne Wort skandiert, womöglich ist das die Stimme des Autors.
Wie es gemacht ist
Karner verwendet durchgehend Kleinschreibung, das betrifft auch die Titel der Gedichte. Insgesamt handelt es sich – geradezu selbstverständlich – um freie Rhythmen. Diese sind oft melodiöser, als der Inhalt vermuten lässt, und dazu dienen auch Wortverkürzungen, bei denen beispielsweise statt einem „das“ nur noch ein „s“ steht. Einiges davon verrät deutlich die Umgangssprache oder sogar den (Kärntner) Dialekt.
Wie schon erwähnt, sind alle Gedichte mit Titeln versehen – diese sind Personenbezeichnungen, Berufe oder Rollen. Manche dieser Bezeichnungen wirken recht ungewöhnlich, steigen solchermaßen voll in die Poesie ein und führen in die zum Teil hinreißend skurrile Gedankenwelt des Verfassers – wie etwa „gattersteher“, „nussklauber“, „schneckensammler“ oder „verwalter des lampenschirms“. Alle Titel sind alphabetisch angeordnet.
Das erste und das letzte Gedicht sind durchgehend kursiv gedruckt. In allen anderen Texten wird die Kursivschrift für einzelne Wörter oder Satzteile eingesetzt. Solcherart werden diese dezidiert betont oder markieren einen kurzzeitigen Perspektivenwechsel. In „köchin“ heißt es etwa:
schneidet die klaue die frau beim schlachter fürs schild schweine schweine gebet ich esse zunge entschlüpft dem mund zu ziehn im kasten welt aus schnee
Die Verse sind in der Regel sehr kurz, bestehen häufig aus einem einzigen Wort. Auch die Gesamtlänge der Gedichte ist recht kurz gehalten und reicht selten über die Halbseite hinaus. Der folgende Ausschnitt stammt aus „ziehharmonist“:
wut lockt brust voran sack furz
Karners Bücher sind generell recht dünn. Dieses hat gerade mal 52 Seiten. Aber auch das hat seinen Reiz: Die Bücher wirken nicht nur physisch, sondern auch inhaltlich wunderbar kompakt.
Wie es gemeint ist
Karners Texte sind generell nicht einfach zu verstehen, denn hier reihen sich ungewöhnliche Zuordnungen an bissige Bemerkungen und ironische Doppelbödigkeiten. Leser*innen sollten sich definitiv Zeit nehmen, um in das sprachliche Universum des Kärntner Autors einzutauchen. Diese Gedichte brauchen nämlich Zeit, um ihre Wirkung zu entfalten.
Von einer rein inhaltlichen Seite her klingt ja manches geradezu nach Nonsens, doch je länger wir uns mit dem jeweiligen Text auseinandersetzen, desto mehr gibt er preis. Das ist nicht nur doppelbödig, sondern durchaus vielschichtig, und es lohnt sich, Wörter genau nach ihrer Bedeutung oder ihrem Bedeutungsfeld hin abzuklopfen, um zumindest annähernd herauszuschälen, was sich in dem Gedicht alles verbirgt oder verbergen könnte. Eines dieser auf den ersten Blick nach Nonsens aussehenden Gedichte ist etwa „daumenlutscher peppe“:
woran mein sandplatz sich schmiegte hab den röhrenwurm erstickt pudding franze begnadeter topfscheißer fällt s glied grad ab dieweil mütterleins einzig kind babel vergöttert
Diese Zeilen verraten eine unbändige Freude am Witzeln und Sticheln ebenso wie an deftigen Kategorisierungen und kulturellen Allusionen. Ob es hier tatsächlich um ein Kind oder doch eher einen gewissermaßen Kind gebliebenen Mann geht, sei einmal dahingestellt.
Ein weiteres Gedicht, das sich einer zu raschen Interpretation entzieht und dazu animiert, auch Geschichtliches nachzuschlagen, ist „anfangs flötzersteigs arzt“:
einige fürbeter bei den armenspeisungen gratuliert der scheitel dass sie an gripp krepieren reichlich eiweiß gemüse wird fehlen die überleben sterilisiert
Die Wiener Klinik Ottakring am Flötzersteig (Wilhelminenspital) hat eine lange Geschichte, die in der Monarchie begann. Sie ist eines der wichtigsten Spitäler in Wien, das stets auch eine starke soziale Komponente hatte. Der Text evoziert aber auch Erinnerungen an die Nazidiktatur. Dass, was allen Wiener*innen bekannt ist, auch die Müllverbrennungsanlage am Flötzersteig angesiedelt ist, verleiht den vielfachen Ebenen des Gedichtes aus meiner Sicht eine zusätzliche, womöglich ironische Note.
Der Wieser Verlag spendierte Karners Lyrik einen festen Einband, zusammen mit dem gewohnt sorgfältigen Satz ergibt sich ein schöner, feiner Gedichtband, den ich gerne zur Hand nehme, um darin zu schmökern und bei einem Text länger zu verweilen – oder auch bei mehreren. Sehr witzig fand ich übrigens das Autorenfoto, denn hier ist Axel Karner auf ein und demselben Hintergrund gleichzeitig frontal und im Profil zu sehen. Eine nette, pfiffige Idee!
Axel Karner: popanz. Wieser Verlag, Klagenfurt/Celovec 2024. 52 Seiten. Euro 18,90




