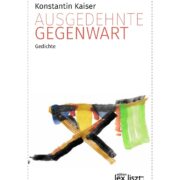Ein Essay zum 150. Geburtstag Rainer Maria Rilkes anhand von zwei neuen Biografien von Kirstin Breitenfellner
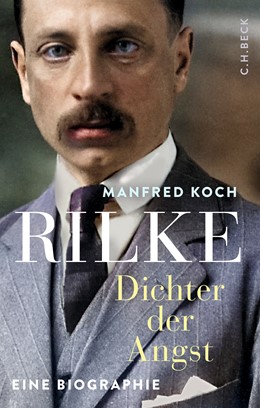
Der 150. Geburtstag Rainer Maria Rilkes jährt sich zwar erst am 4. Dezember, aber das Jubeljahr für den international wohl bekanntesten Dichters deutscher Sprache hat bereits mit Januar begonnen. Wo viel Ruhm ist, ist auch Kritik nie weit. Bei Rilke tritt sie oft in der Form von Naserümpfen auf. „Zur Bedeutung des Belanglosen“ titeln etwa die Feldkircher Literaturtage 2025 und setzen mit dem Slogan „Was kümmert uns Rilke“ noch eins drauf. Zumindest kümmert der Dichter soweit, sich mit ihm zu beschäftigen.
Cover © C.H.Beck
Ja, Rilkes Lyrik ziert Kalenderblätter, den Arm von Popstar Lady Gaga als Tattoo und erlebt auf Instagram einen wahren Hype. Aber kann man daraus Schlussfolgerungen über den mangelnden Wert seines Werks ziehen?
Unbestritten ist die kulturhistorische Bedeutung der Figur Rainer Maria Rilkes in der europäischen Kulturlandschaft seiner Zeit. Er wurde nur 51 Jahre alt, war aber nicht nur mit unzähligen Kulturschaffenden und Politikern seiner Zeit bekannt und befreundet, sondern schrieb auch in zwei Sprachen. Und hinterließ, was selbst Lyrikaffinen oft nicht bekannt ist, über 400 Gedichte auf Französisch, die immerhin die Anerkennung von André Gide erlangten.
Seinem Leben sind deswegen gleich zwei umfangreiche, im Frühjahr erschienene Biografien gewidmet, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Sandra Richters „Rainer Maria Rilke oder Das offene Leben. Eine Biographie“ erhielt bislang mehr Aufmerksamkeit. Deswegen sei mit ihr begonnen. Schon der Titel der zweiten Biografie, Manfred Kochs „Rilke. Dichter der Angst. Eine Biographie“ deutet auf eine andere Zielrichtung hin. Das Offene versus die Angst. Vermutlich stimmt beides. Aber trotzdem gelingt es Koch, so viel sei hier schon verraten, auf viel tiefgründigere Weise, das Werden und Wollen Rilkes auf den Punkt zu bringen.
Fluide Geschlechtlichkeit
„Offen sein und schreiben, mehr wollte Rilke nicht: ein bescheidener und zugleich anspruchsvoller Wunsch.“ Mit diesem Satz hebt Richters Biografie an, um gleich im dritten Absatz Theodor W. Adornos Kritik an Rilkes Gedichten als „protofaschistisch“ zu zitieren. „Rilke dichte bräunlichen Kitsch für eine kulturell ignorante ,Konsumgesellschaft‘, verfertigte Trostsprüche als ,Massenartikel‘, schimpfte Adorno.“ Ganz sicher hat Adorno damit bis zu den heutigen Verächtern des „Belanglosen“ die Rilke-Rezeption beeinflusst. Aber beide vorliegenden Biografien geben ihm damit nicht recht.
Cover © Suhrkamp/ Insel Verlag
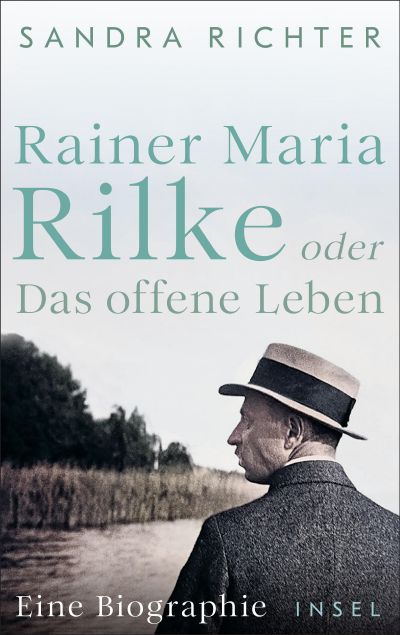
Den Aufstieg der Nationalsozialisten und ihre grausame Politik zu erleben blieb Rilke erspart, der am 26. Dezember 1926 starb. Und wer an ihn anknüpft, kann sich getrost als in der Tradition der Moderne stehend einordnen. Schließlich schrieb Rilke mit den „Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“ von 1910, die in den Pariser Elendsvierteln einsetzen, einen der ersten europäischen Romane der Epoche.
Sandra Richter, Direktorin des Deutschen Literaturarchivs in Marbach, beschreibt sein Leben anhand von fünf Werkphasen, wobei die Werke selbst erstaunlich wenig Platz einnehmen. Man sollte sie also kennen – oder gewillt sein, ein Dichterleben ohne Werkbezug zu konsumieren. Spannend bleibt es allemal. Die Frauen in Rilkes Leben werden hingegen gut beleuchtet, beginnend mit der schillernden Mutter Phia Rilke, die den kleinen René (als Ersatz für seine früh verstorbene Schwester) in Mädchenkleider steckt und ihm so eine fluide Geschlechtlichkeit verpasst, die er bis zum Lebensende bejahen sollte. Gemeinsam mit seiner Geliebten und Wahlmutter Lou Andreas-Salomé – Rilke fühlte sich zu älteren Frauen hingezogen, aber auch zu Mädchen an der Schwelle zum Frausein – bekannte er sich noch als Erwachsener zur „Produktivität der Doppelgeschlechtlichkeit“. Kein Wunder, dass er den Drill in der Militärschule in St. Pölten nicht aushielt.
Poet des Unbewussten
Sein Leben auch nur in Ansätzen nachzuerzählen, würde den Rahmen dieses Essays sprengen, deswegen seien hier nur Eckpunkte genannt. Er verkehrte in der Künstlerkolonie Worpswede, wo er seine spätere Frau kennenlernte, er besuchte mit Lou Andreas-Salomé Tolstoi in Russland, erlebte seinen Durchbruch als Vortragender in Wien, arbeitete als Sekretär von Auguste Rodin, übersetzte Baudelaire, Proust und Gide, Dante und D’Annunzio, war befreundet mit Walther Rathenau und Sophie Liebknecht, stand im „Epizentrum der frühen Psychoanalyse“, verweigerte aber selbst eine solche, um seine Kreativität zu schützen. Tatsächlich habe er, meint Richter, die bipolare Störung seiner jungen Jahre „bis zu einem gewissen Grad“ ausgleichen können – und wurde dennoch oder gerade deswegen ein „Poet des Unbewussten“.
Rilke war beeinflusst von der Lebensreformbewegung, ernährte sich vegetarisch, nahm gerne „Luftbäder“ und ging barfuß. Österreicher dem Pass nach, scherte er sich nicht um Nationalitäten, sondern lebte in Deutschland, Schweden, Italien, Frankreich und der Schweiz, bereiste Russland, Spanien und Ägypten und siedelte seinen „Malte“ in Dänemark an – ein überzeugter Europäer. Er pflegte mit seiner Tochter Ruth, um die sich zu kümmern ihm seine Berufung zum Dichter (oder sein Narzissmus) verbot, eine witzige „Briefvaterschaft“ und ließ ihr eine seiner eigenen entgegengesetzte Schulbildung zukommen – geprägt von der reformpädagogischen Bewegung.
Rilkes Impulse zu schreiben, konstatiert Richter, „speisen sich zwar aus dem Düsteren und Unverarbeiteten, aber dieses transzendierte er, sodass es schien, als hafte selbst dem Abscheulichsten Schönes an“. Dabei habe er sich herausgenommen, das Dasein zu rühmen, seine schönen Seiten zu preisen, „ohne die schwierigen zu verschweigen“ – als eigene Ausdrucksform gegen die Widrigkeiten der Außenwelt“.
Dabei unterstützten ihn stets starke Frauen. Seine erste Freundin in Prag, Valerie von David-Rohnfeld, Lou Andreas-Salomé, seine Frau, die Bildhauerin Clara Rilke-Westhoff, die Reformpädagogin und Feministin Ellen Key, Mäzeninnen wie Marie von Thurn und Taxis, auf deren Schloss Duino er die berühmten Elegien begann, die Verlegerin Katharina Kippenberg und zuletzt die Künstlerin Baladine Klossowska, ohne die das Spätwerk undenkbar wäre.
Richter schildert Rilke, den selbsterklärten Einsamen, der als Frühchen auf die Welt kam, als ebenso zart wie robust – ein „Zentralgestirn der zeitgenössischen Gesellschaft und des Literaturbetriebs, umtriebig und mit vielen verbunden“, der auch als Lektor, Scout, Influencer und Übersetzer tätig war.
Sinnstifter in der Düsternis der entgötterten Moderne
„Rilke bot sich immer an als Sinnstifter in der Düsternis der entgötterten Moderne, darauf beruhte seine immense Wirkung auf eine weltweite Leserschaft“, schreibt der Germanist Manfred Koch, der heute mit seiner Frau Angelika Overrath eine Schule für Kreatives Schreiben im Engadin leitet, im Vorwort seiner Biografie. Im Zentrum dieser steht nicht das Leben des Autors, sondern dessen Niederschlag im Werk.
Koch setzt daher auch in Paris im Jahr 1902 ein, wo der 26-jährige Dichter Rilke sein größtes Prosawerk, den „Malte“, begann. Dieser Zugang erweist sich als fruchtbarer, das Phänomen Rilke zu verstehen, als der chronologische Ansatz Richters. Wer also nicht nur etwas über Rilkes Biografie erfahren will, sondern über das „Leben im Werk“ und das „Werk im Leben“ – dem sei Kochs „Dichter der Angst“ ans Herz gelegt, das wegen seiner langen exegetischen Passagen allerdings auch anspruchsvoller zu lesen ist.
„Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge sind große Angst-Kunst, in der deutschen Literatur gleichrangig mit Erzählungen wie Georg Büchners Lenz oder Gerhart Hauptmanns Bahnwärter Thiel“, schreibt Koch, „einer der ersten Romane, die virtuos den Ekel ästhetisieren, d.h. ihn zum Element einer mitreißenden Prosa machen.“ Denn Maltes Schockerfahrungen in der Großstadt im Angesicht der sozial Deklassierten, Kranken und Entstellten seien keine Klage über das Elend der „Fortgeworfenen“, sondern Ausdruck einer existenziellen Verstörung. Auch in Rilkes berühmtem „Panther“ erkennt Koch „keine Spur von Wehleidigkeit und Selbstverliebtheit“, sondern interpretiert ihn als „Ich-Gedicht ohne Ich“.
Auch Koch definiert Rilkes Konzept als „Poetik des Unbewussten“, als deren Keimzelle er seinen Rodin-Essay von 1903 ausmacht, dem er allerdings eine Mythisierung des Bildhauers ankreidet. Aus Paris reist das „Fluchttier“ Rilke für ein halbes Jahr nach Italien. Die Leserinnen und Leser begeben sich allerdings mit Koch zurück in Rilkes Kindheit.
Muttervergiftung und die schreibende Hand
Diese war ebenso behütet wie umschattet. Die Ursache dafür sehen Koch wie auch Richter in Rilkes Beziehung zur Mutter, einer „ungewöhnlich emanzipierten Frau“, die „Symptome einer narzisstischen Persönlichkeit“ aufgewiesen habe. „Rainer Maria Rilke – das lässt sich mit Sicherheit sagen – litt lebenslang an einer Muttervergiftung.“
Während Richter Rilkes Freundschaften mit Mädchen (darunter zuletzt die Wienerin Erika Mitterer) unter die Lupe nimmt und unter den Verdacht pädophiler Beziehungen stellt, begibt sich Koch auf die Suche nach der Ursache für Rilkes zwanghaftes Masturbieren – und findet Indizien für einen Missbrauch durch die später verhasste Mutter – eine der beklemmendsten Stellen im Buch. War sie der dunkle Punkt, aus dem sein Schreiben den Ursprung nahm? Rilkes Diktum „Das Furchtbare ist die Voraussetzung des Fruchtbaren“ legt diese Interpretation nahe.
Dem Frühwerk Rilkes, aus dem „einer der großen Manieristen der Weltliteratur“ werden sollte, bescheinigt Koch gnadenlos: „Kaum ein anderer großer Autor der deutschen Literatur hat so miserabel begonnen wie Rilke.“ Rilkes Leben war auf die Durchsetzung seiner literarischen Berufung ausgerichtet. Dazu habe er seine Wahlmütter und Geliebten, seine Mäzeninnen und Mäzene, seine Haushälterinnen und Krankenschwestern, seine Fluchten und Einsamkeit gebraucht – die er rücksichtslos durchzusetzen verstand, wie Koch betont. Auf dem Weg zu seinen Dinggedichten – zu denen neben dem „Panther“ und dem „Karussell“ auch der „Archaische Torso Apollos“ gehört –, gab er seine frühere Gefühligkeit auf, um „alles Subjektive in die Gestaltung des Gegenstands“ zu verlegen.
Trotzdem, konzediert Koch, blieb Rilke zeitlebens ein gnadenloser Romantisierer. Seinen „Beschönigungstrieb“ lebte er nicht nur in seiner Wohnraumgestaltung und der späteren Rosenzucht auf Château Muzot im Schweizer Wallis aus, sondern auch in Form von Ausblendungen. Kennzeichen der Moderne wie Eisenbahn, U-Bahn, Telefon und Radio kommen in seinen Gedichten nicht vor. Darin erweist er sich für Koch wie Hugo von Hofmannsthal als restaurativ oder konservativ. Doch Koch hält fest: „Es gibt bei Rilke fast immer einen Punkt, an dem seine Mythisierungen umschlagen in produktive Erkenntnis. Die Übertreibung führt hin zu klugen Einsichten in konkrete künstlerische Verfahren.“
Beim Schreiben musste für Rilke alles verschwunden sein, was er war, wusste und erinnerte. Es werde „ein Tag kommen, da meine Hand weit weg von mir sein wird, und wenn ich sie schreiben heißen werde, wird sie Worte schreiben, die ich nicht meine“, notierte er einmal. Viele Gedichte empfing er als empfundenes „Diktat“. Der Dichter müsse berauscht und gleichzeitig klar im Kopf sein, fand Rilke. Wie kein anderer Autor der frühen Moderne, präzisiert Koch, habe Rilke „den Anteil der Nicht-Planbarkeit im kreativen Prozess herausgestrichen“.
Selbsttherapie eines nicht-ichbezogenen Narzissten
Rilke war nicht beziehungsfähig – außer in Briefen. Sein Glück lag einzig im „gelingenden Schreiben“, meint Koch. Im „Malte“ habe er versucht, sich selbst zu porträtieren und gleichzeitig von sich loszukommen, aber das sei nicht gelungen: „Schreiben als missglückte Selbsttherapie, als Entfesselung statt Bändigung der Krankheitsgewalten“. Folgt man Kochs Interpretation, kam Rilke nie über den „Malte“ in sich selbst, über den missbrauchten Jungen hinweg. Am Beginn seiner letalen Leukämie stand ein panischer Schock, den Koch mit Rilkes Kindheit und Mutterbeziehung in Verbindung bringt. Von Rücksichtslosigkeiten und Dressurakten, Verrücktheiten und Überforderungen ist dabei die Rede, einem „sanften Zwangssystem“, an dem Malte/Rainer-René zerbrechen sollte. Rilke vermochte sich nicht zu retten, deswegen erkennt Koch in seinem Programm – die Welt neu zu schreiben – auch keinen Größenwahn, sondern das „letzte Rettungsmittel eines Verzweifelten“, eines soziophoben Außenseiters, dem oft Narzissmus bescheinigt wird, was Koch gelten lässt, wenn man der Diagnose das Adjektiv „nicht-ichbezogen“ voranstellt. Im Laufe seines Lebens verlor Rilke die Borderline-Symptome seiner jungen Jahre, dafür wurde ihm der Körper zum Feind. Koch liest die „Duineser Elegien“ als „Seelendrama mit mythischen Akteuren“, als Zeugnisse seiner Masturbationssucht als Betäubungsmittel tiefer Wunden und –das Motiv der Engel als Narzissmus in übermenschlicher Reinform, aber auch als Versuch einer literarischen Selbsttherapie des „Dingemachens aus Angst“.
„Das Tötliche hat immer mitgedichtet“
Sah Rilke den „Durchgang der Hölle“ als „Königsweg zur Kunst“, so fiel er ein Jahr vor seinem Tod in ein Loch, jenen Schockzustand, den Koch eindringlich beschreibt und – wie bereits erwähnt – mit einem vermuteten Missbrauch durch die Mutter in Verbindung bringt. „Besonders unheimlich mutet unter diesem Aspekt ein Passus in der dritten [Duineser] Elegie über das ,Entsetzliche‘ der ersten Erfahrung von Sexualität im Leben des Knaben an:
Ja, das Entsetzliche lächelte … Selten hast du so zärtlich gelächelt, Mutter. Wie sollte er es nicht lieben, da es ihm lächelte.“
Aus der Kombination von extremer Todesangst und suchtartiger Selbstbefriedigung sollte Rilke nicht mehr herauskommen. Gestorben ist er schließlich an einer Wunde durch einen Rosenstachel, die aufgrund seiner fortgeschrittenen Leukämie nicht mehr heilte. Der jungen Wiener Dichterin Erika Mitterer, seiner letzten Mädchenbeziehung, bekannte er in Gedichtform: „Das Tötliche hat immer mitgedichtet: nur darum war der Sog so unerhört.“
Nach dieser Lektüre wird man Rilke mit anderen Augen sehen, über die ihm nachgerufene Harmlosigkeit nur noch müde lächeln – und womöglich darauf warten, dass die unterschiedlichen Interpretationen Richters und Kochs durch weitere Exegesen von Dichter und Werk ergänzt werden. „Rainer Maria Rilke. Ein Prophet der Avantgarde“ von Rüdiger Schaper erscheint übrigens im August. Derweil könnte man auf eine der bereits vorhandenen Monografien zurückgreifen wie „Rainer Maria Rilke. Überzähliges Dasein“ von Fritz J. Raddatz (2009), „Rilke und die Frauen“ von Heimo Schwilk (2015), „Rilke. Der ferne Magier“ von Gunnar Decker (2023). Oder doch einmal wieder den Dichter selbst lesen.
Sandra Richter: Rainer Maria Rilke oder Das offene Leben. Eine Biographie. Insel, Berlin, 2025. 478 Seiten. Euro 28,80
Manfred Koch: Rilke. Dichter der Angst. Eine Biographie. C.H. Beck, München, 2025. 560 Seiten. Euro 35,–
„Kunst ist Kindheit. Kunst heißt, nicht wissen, daß die Welt schon i s t, und eine machen. Nicht zerstören, was man vorfindet, sondern einfach nichts Fertiges finden.“
(Aus: Rainer Maria Rilkes Erzählung „Im Gespräch“)