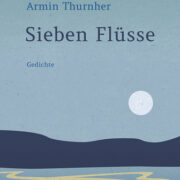Klaus Ebner liest Ingrid Puganiggs Bleib. Fraktale
Fraktale sind geometrische Muster oder Objekte, die nicht durch ganzzahlige, sondern gebrochene Dimensionen gekennzeichnet sind. Oft enthalten sie Kopien von sich selbst, wie man in der bekannten Mandelbrot-Menge, dem sogenannten Apfelmännchen, gut beobachten kann. Auf die Lyrik angewandt, versprechen die Verse iterative Gedanken, mäandernde Gefühle und mehrdimensionale Bedeutungsebenen. Bleib ist ein Langgedicht in neunundvierzig Teilen, das, ausgehend von einem schmerzhaften persönlichen Verlust, stets größere Kreise zieht, wieder auf den Verlust zurückkommt und abermals weit in Erinnerungen ausgreift.
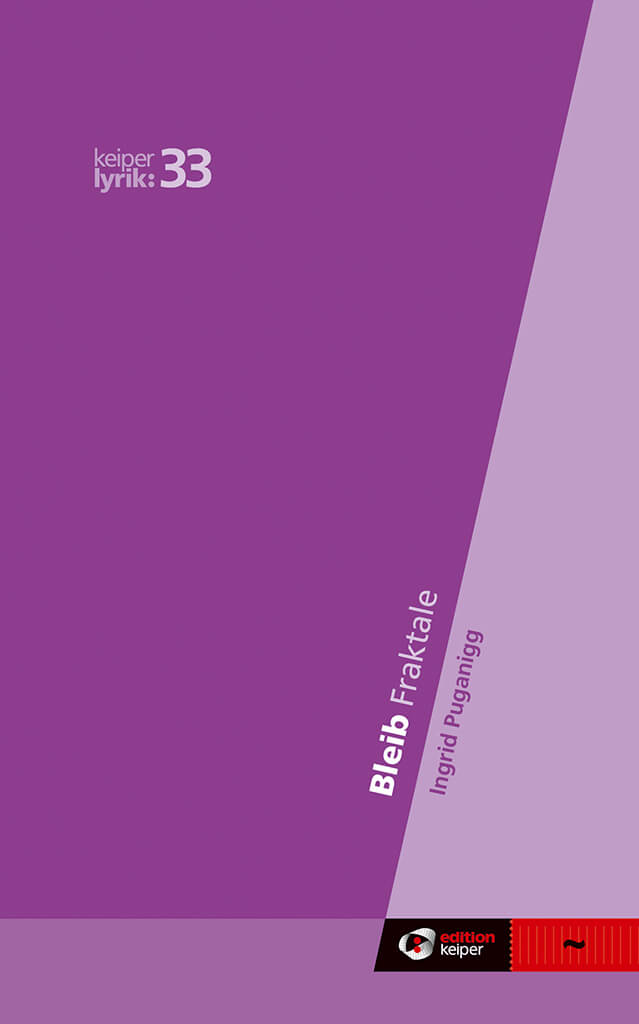
Ingrid Puganigg wurde 1947 in Kärnten geboren, lebte lange Zeit mit ihrem Mann und den Töchtern in Vorarlberg, dann in der Nähe von Hannover. Laut der im Buch enthaltenen Biografie plant sie ihre Rückkehr nach Vorarlberg. In den 1980er Jahren wurde sie beim Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet, und in der Verfilmung ihres Romans Fasnacht unter dem Titel Martha Dubronski (1984) spielte sie selbst die Hauptrolle. Puganigg veröffentlichte Romane, Lyrik und Hörspiele (ORF und WDR).
Cover © Edition Keiper
Puganiggs Ehemann verstarb 2022, und das ist der Ausgangspunkt ihres Langgedichts. In einem Interview meinte die Autorin dazu, sie hätte schreiben müssen, um „nicht verrückt zu werden“.
Ich suche deine Schuhe oder sind es meine. Sie passen mir nicht mehr. Wir kauften unsere Bekleidung immer um zwei Nummern zu groß. Die Tage sind so heiß geworden. Die Pflanzen schreien zum Himmel. Warten auf den Regen, diese herabstürzenden Orgeln.
Es sind scheinbar lapidare Sätze wie diese, welche die Trauer spüren lassen. Manche Bilder sind stellvertretend zu verstehen, denn es sind keineswegs nur die Pflanzen, die zum Himmel schreien.
Verlust und Trauer
In freien Rhythmen vermitteln die Gedichte zahlreiche Erinnerungen. Es sind fröhliche Erinnerungen, aber auch ganz banale Alltagsszenerien, die sich rückblickend als eine vertraute und nun verlorene Gewohnheit entpuppen.
Formal wirken die Gedichte oft wie Prosa. Puganigg schreibt vollständige Sätze und versieht diese mit rechtschreibkonformen Satzzeichen. Viele Sätze sind sehr kurz und entsprechen in diesem Fall einem Vers, andere werden über ein Enjambement umbrochen. Es gibt aber auch Verse, die so lang sind, dass sie offensichtlich nur aufgrund der Satzspiegelbreite umbrochen werden mussten. Die folgende Strophe enthält kurze Sätze; eine Erinnerung an die Anfangszeiten einer wunderbaren Paarbeziehung:
Ich trage ein moosgrünes Seidenkleid. Meine Schuhe sind klobig. Mein Haar ist sehr kurz. Du beobachtest mich. Wir schweigen. Wir wissen es. Kein Entrinnen. Nie mehr.
Der Verlust des Ehemannes brachte größere wirtschaftliche Sorgen mit sich. Armut, ein Leben im Prekariat: Die immer wieder auf dieses Thema zurückgreifenden Strophen lassen eine reale Bedrohung vermuten. Im „Zwölften Teil“ heißt es unter anderem:
Hilf mir, damit ich nicht im Boden stecken bleibe.
Ich habe Angst, die alte Wohnung zu verlieren und keine neue zu bekommen.
Hilf mir, wenn ich draußen ohne Sessel und ohne Bett sein werde.
(…) Jetzt bin ich ohne dich. Bewege mich wie ein angeschossenes Kätzchen.
Doch die empfindsamen Erinnerungen überwiegen. Jene Begebenheiten und Momente, aus denen viel Zärtlichkeit spricht. Die Verse geben oft einen kurzen Dialog wieder. Ob dieser aus einer realen Erinnerung kommt oder imaginiert ist, bleibt offen; im Grunde spielt das auch keine Rolle, denn was zählt, ist das durch die Worte erzeugte Gefühl.
Ich vermisse dein Lachen. Nimm mir den Hunger. Meine Schöne, schlaf den Hunger aus.
Diese Passagen wechseln sich ab mit Erinnerungen an die gemeinsame Zeit. Gemeinsames Essen, der Haushalt, Ausflüge und Aufenthalte in der Natur, ebenso wie die gemeinsam erlebte Erotik. Das einsame Jetzt bricht dabei wiederholt durch.
Wie gern wäre ich an deinem Urnengrab und würde Narzissen auf deinen Namen legen. (…) Der Tod hat dich von mir weggezerrt. Meine bittersüße Liebe, ich suche dich überall, aber niemand kennt dich. (…) Unsere Körper zwei Klänge. Spiegel im Spiegel. Auf der Fahrt durch Wien. Arvo Pärt. Was für ein klares Weinen für das Leben.
Ingrid Puganigg spielt auf eine Reihe von Liedern und Musikstücken an. Komponisten und Titel werden namentlich genannt, manchmal zitiert sie hingegen eine Textzeile. Im Anhang des Buches werden alle angesprochenen Stücke aufgelistet. Auch diese Musikstücke, die gemeinsam gehört wurden, zeigen eine Verbundenheit, die weit über den Tod hinausreicht.
Kindheit und Lebensbeziehung
Zahlreiche Erinnerungen gehen auf die Kindheit zurück. Beim Lesen hatte ich den Eindruck, dass insbesondere diese Passagen wie Prosa wirken; die vorkommenden Silbentrennungen verstärken diesen Eindruck. Es geht um den Garten der Eltern und um das, was die Kinder damals wahrgenommen und von dort quasi mitgenommen haben. Im „Vierzigsten Teil“ heißt es:
Im leerstehenden Haus der Eltern machten wir Ur- laub. Kamen wir dort an, wuchsen aus den Ritzen des ebenerdigen Holzfußbodens. Halme. Vor der Veranda blühte ein Rosenstock. Um das Haus Grün. Morgens kamen die Rehe. Die Sauerwiese war tagsüber voller Flusen. Der Wildbach kalt und laut. Es gab Blind- schleichen und eine Äskulapnatter.
Geradezu idyllische Szenerien leiten mitunter zu ernsten Themen über; zu häuslicher Gewalt, zum politischen Missbrauch der Legislatur und zu den Kriegen der Welt, insbesondere aber zur täglichen Armut. Dabei setzt die Autorin ihre Hinweise äußerst sparsam ein. Aufmerksamen Leser*innen entgehen sie trotzdem nicht.
Wir waren klein. Waren mit noch zwei Freundinnen allein zuhause. Die Eltern mussten für ein paar Stunden weg. Wir spielten. Plötzlich fielen Schüsse. Wir sahen Soldaten. Wir dachten, es ist Krieg, und versteckten uns.
Die lapidare Formulierung „Der Krieg ist ein Meistersinger“ wirkt genau genommen wuchtiger als eine beliebige realistische Beschreibung des Grauens. Zudem erinnert mich das Wort „Meister“ an Paul Celans „Todesfuge“ mit der berühmten Zeile „Der Tod ist ein Meister aus Deutschland“.
Was kosten die Schreie der Zusammengeschlagenen, das Betteln der Ausgestoßenen. Das Lachen der Lehmfresser und Schadenfrohen. Das letzte Hemd.
Mit ökonomischen Schwierigkeiten kämpfen in letzter Zeit immer mehr Menschen. Steigende Mietkosten, explodierende Energiepreise, eine Inflation, die für Unverzichtbares deutlich höher liegt, als die offiziellen Zahlen glauben lassen. Die folgenden Zeilen weisen eindringlich darauf hin:
Ich habe kein Waschpulver. Wohin ich auch schaue, reißt es mich in die Tiefe. Der König sagt, es ist noch genug Luft nach oben. Die Armut ist für alle da. Man braucht sich dazu nicht einmal zu bücken.
Ingrid Puganiggs Buch erschien in der Lyrikreihe der Grazer edition keiper. Es ist ein handliches Taschenbuch, das diesem emotionalen und nachdenklich stimmenden Langgedicht einen würdevollen Rahmen bietet.
Ingrid Puganigg: Bleib. Fraktale. edition keiper, Graz 2025. 206 Seiten. Euro 16,50