Rhea Krčmářová liest Isabella Feimers Versuch einer Verpuppung
Versuch einer Verpuppung – ein Titel, der neugierig macht. Die Biologie definiert eine Verpuppung als Entwicklungsstadium im Leben von Schmetterlingen und anderen Insekten, als Metamorphose zwischen Raupe und dem erwachsenen Tier. Während dieser Zeit der Verwandlung hüllt die Raupe sich oft in einen selbst gesponnenen Kokon oder sucht sich einen geschützen Ort. Dort löst sie sich zu einem Brei auf, aus dem sich Flügel und andere Teile des Insekts bilden, und entflattert dann in ein Lebens als quasi neues, erwachsenes, fertiges Geschöpf.
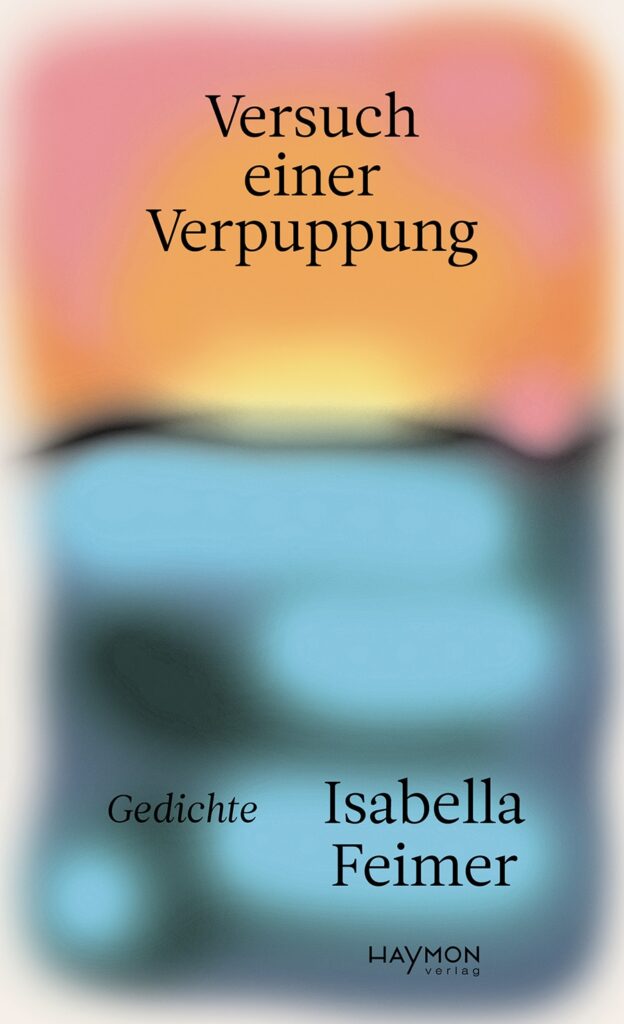
Wie kann aber ein Mensch eine Verpuppung versuchen, methaphorisch und vor allem literarisch? Was beinhaltet dieser Versuch? Ein Risiko des innewohnenden Scheiterns, das miteingerechnet wird, so wie ein mögliches Gefressenwerden im schutzlosen Stadium? Ein Herantasten an eine naturnahe Körperlichkeit? Oder ist die Sehnsucht nach Rückzug und Transformation gemeint?
Cover Haymon Verlag
vom Schmetterling zur Raupe ein Rückwärtsflug und Versuch einer Verpuppung meine Arme meine Beine Hals und Halsschlagader spür ich pochen Töne kratzen aus mir ich verschlucke sie spinne sie um das was Herz sein kann die Flügel glänzend ultraviolett ich zieh dich an ich schäme mich (...)
Naturmotive durchziehen Isabella Feimers bei Haymon erschienenen Gedichte als Konstante durch die drei Teile des Buchs, entstanden in verschiedenen Ländern. Konsequenterweise beginnt Versuch einer Verpuppung mit einem Zitat der irischen Schriftstellerin Claire Keegan: „Aber das hier ist ein neuer Ort, und ich brauche neue Wörter.“ Isabella Feimer ist eine Autorin, die nicht nur neue Worte, sondern auch neue Orte braucht. Sie ist vielleicht keine klassische Reiseschriftstellerin, aber eine reisende Schriftstellerin.Immer wieder thematisieren ihre Bücher das ausgedehnte Erkunden anderer Länder. Teil eins der Gedichte entstand an ihrem Wohnort Wien, Teil zwei schrieb sie auf der irischen Insel Achill Island während eines Schreibaufenthalts im Heinrich Böll Cottage. Der dritte Teil ist mit „Andalusien | Latium | Berlin | Wien“ übertitelt – im Nachwort bedankt sich die Autorin für Residenzen im italienischen Paliano und in der LiterarMechana-Wohnung in Berlin.
Naturmetaphern in Großstadtgenese
Der Entstehungsort spiegelt sich im ersten – Wiener – Teil des Gedichtbands kaum in den Texten wider. Stattdessen begegnen einem die beiden Motive, die sich durch das gesamte Buch ziehen: Einerseits Stimmungs- und Selbstbeschreibungen, in denen sich Körperliches mit Naturmotiven mischt, mit Zeilen wie „lianenwild bis zu dem Schenkeln“ oder „Vogelspuriges gespreizt auf Knien“. Andererseits liest man immer wieder fragmenthafte Zwiegespräche mit einem Du – Anrufungen, Feststellungen, zart melancholische Konversationen. Das lyrische Ich und das Du können auch zum Wir werden, und das klingt dann so:
Seite an Seite wachsen wir unsere Blätter wollen sich berühren tun es nur an den Wurzeln du bist die Dunkelheit in die ich fließen kann will eins sein mit dir will nichts so ohne dich siehst du in den Spiegel siehst du mich sehe ich in den Spiegel bist du in meiner Nacht gefangen trinkst Mondwasser wie Luft staust dich in verdickter Atmosphäre
Es sind keine Liebesgedichte, sondern Gedichte von Liebenden, von komplizierten Beziehungsstrukturen und fein beobachteten Gefühlsspektren und auch von emotional spectres im Sinne von emotionalen Schreckgespenstern.
Heinrich Böll und Muschelsplitter
Im zweiten Teil merkt man die Verbindung zwischen den Gedichten und dem Entstehungsort am stärksten. Achill Island ist ein Inselchen am westlichsten Zipfel Irlands, der vielleicht bekannteste Schriftsteller, der sich dort in ein Häuschen am Meer zum Schreiben zurückzog, war Heinrich Böll. Das von Wind und Wellen umtose Eiland und seine Bewohner beschrieb Böll in seinem Irischen Tagebuch (1957). Isabella Feimers Gedichte entstanden während eines Aufenthalts in Bölls Cottage, und man spürt den Einfluss der Natur und der Gezeiten auf die Texte.
Die meisten Gedichte sind am Meer verortet, die See und ihr Umland finden sich in kleinen Details wieder. Die Autorin beschreibt einen Muschelsplitter genauso wie angespülte, in sich selbst verschlungene Medusen oder „Drahtseilakte entlang der Brandung“. Auch hier treffen Naturmotive und Körperliches auf Dialoge mit einem Du, wobei zumindest eines der Gedichte auch als Selbstgespräch in Du-Form gelesen werden kann.
leer bist du gedichtet verkrustet an den Ufern verwunschen in Dämmerung Träume unter deiner Haut sie branden nicht
Ebenso wie im ersten Teil fügen das Ich und Du sich in einigen Gedichten zu einem Wir, wobei die Sehnsucht und die Anflüge von Melancholie auch in diesem Teil die Stimmung beherrschen. Dennoch sind die Elemente von körperlicher Natur keinesfalls nur idyllisch und lieblich, in Feimers Gedichten brechen Haut und Abgründe auf. Das lyrische Ich ritzt sich an Scherben und Korallen, spricht von Schnitten und Narben. Auch hier finden sich Texte, die mit dem Element der Metamorphose spielen.
ich setze Knochen falsch zusammen gebe ihnen Fleisch und Blut aus mir Muskelmasse und ein Netz aus Adern Sehnen Haut Fell und Federn aus dir in das Fell hinein ein Schweif aus Schuppen eine Zunge die an ihrer Spitze gespalten ist es hinkt das Tier kann sich auch schlängeln kann fliegen und fliegt es höre ich seine Knochen laut
Ausdehnungen ins Land der Prosa
Sind in den ersten zwei Teilen die Gedichte selten länger als eine halbe Seite, findet man im letzten Abschnitt auch längere, beinahe prosahafte Lyrik. Ebenso wie in Teil eins und zwei tragen die Gedichte keine Titel, man kann nur raten, wo genau die einzelnen Gedichte entstanden sind, ob in Paliano, Berlin oder anderswo. Die Gedichte in den ersten Teilen kommen (bis auf sparsam eingesetzte Fragezeichen) überwiegend ohne Satzzeichen aus, bei den längeren, prosaartigen Texten im letzten kommen vereinzelt Satzzeichen zum Einsatz. Dass Anfangssätze, die klassisch mit einem Punkt enden, teils mit einem Kleinbuchstaben beginnen, erschließt sich dabei nicht ganz.
Bei einem der längeren Gedichte (Seite 120/121) ist nicht ganz klar, ob es ein Text ist oder zwei – interessanter Weise sind beide Lesarten schlüssig.
Stilistisch unterscheiden sich einige Gedichte im dritten Abschnitt von den anderen, auch wenn die Motive gleich bleiben wie in den ersten, sind erzählender, prosahafter, ausladender. Die sanfte Ausuferung dieser Texte steht im Kontrast zu Feimers gekonnter, kunstvoll und präzise gearbeiteter Verknappung der kürzeren Gedichte. Bei einigen der Prosagedichte fragte ich mich, wie sie klingen würden, hätte die Autorin sie verknappt und den kürzeren Texten angeglichen.
die Stadt kommt um uns herum an, verschließt uns in ihrer Schmuckkästchenattitüde. Schmuck auch das Licht des Vorfrühlings, eine gemeine Verlockung, dabei eine Ahnung von Tod und ein Vermissen. Wir vermissen und vermessen uns sowie die anderen, die wir abwesende Freunde und ferne Feinde nennen. In der Schatulle. Schmuck auch die Risse im Asphalt und dass es drängt und grünt aus ihnen.
Auch in letzten Abschnitt sucht das Ich nach Worten für den Kontakt mit dem Du, auch hier beschreibt die Autorin eine Metamorphose von Natur und Körper und umgekehrt. Trotz dieser Themen, die sich wie Seidengespinste eines Raupenkokons durch den Gedichtband ziehen, hat man nicht das Gefühl, dass die Texte sich wiederholen, die Autorin sucht und findet für die gleichen Motive immer neue Worte und Nuancen. Der literarische Versuch einer Verpuppung ist also definitiv gelungen.
Isabella Feimer: Versuch einer Verpuppung. Gedichte. Haymon, Innsbruck, 2025. 128 Seiten. Euro 22,90




