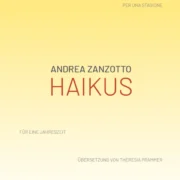Rhea Krčmářová liest Andrea Kerstingers irgendwo dazwischen
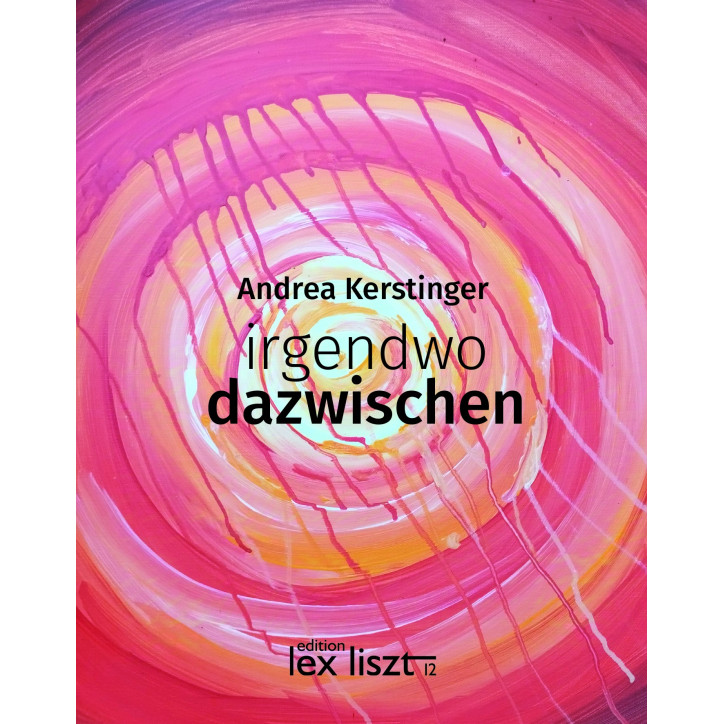
Es liegt in der Natur von Büchern, dass sie beim Lesen Fragen aufwerfen, über die Welt als solches, die Textur der Gesellschaft, aber auch über das Wesen von Gattung und Form. Eine wieder und wieder gestellte Frage beim Lesen von Gedichten ist: Was ist Lyrik überhaupt?
Cover © lex liszt
Was genau macht dieses Genre aus? Gibt es klare Anforderungen, Grenzen, kann im postmodernen Zeitalter nicht alles ein Gedicht sein, wenn man es nur als ein solches ausweist? Sanja Abramović schreibt in einem ihrer Texte: „Und was ist schon ein Gedicht außer der Problematik der Zeilenumbrüche?“
Was also macht ein Gedicht aus? Der Reim? Die Verknappung? Die erwähnten Zeilenumbrüche? Wird Kurzprosa zum Gedicht, wenn man den Text nur ausreichend zerhackt und auf verschiedene Zeilen ausbreitet? Auf dem Vorsatzblatt von irgendwo dazwischen, dem zweiten Buch der burgendländischen Autorin Andrea Kerstinger, steht eindeutig „Gedichte“. Trotzdem machen viele der Texte den Eindruck, als seien sie eher Kurzprosa mit Zeilenumbruch. Der Verlag schreibt, ihre Gedichte und Kurztexte überschritten „fließend mögliche Zuschreibungen“. Ist der Titel deshalb gewählt, weil viele der Texte „irgendwo dazwischen“ liegen? Die Frage bleibt, warum der Band als reiner Gedichtband ausgegeben und die Texte in Versform gedruckt wurden.
Wenn ich an dich denke, ziehen Erinnerungsfetzen vor meinem geistigen Auge vorbei wie Wolken in immer neuen Formationen. Doch der Wind treibt sie weiter, sie müssen sich beeilen, ziehen weiter fort. Wie gerne hielte ich sie länger fest. Auch wenn ich Sommertage liebe, möchte ich die Wolken nicht missen, der Himmel soll strahlen, doch niemals wolkenlos sein.
Texte wie der obere werfen weitere Fragen auf (wobei sie vermutlich nicht die sind, die die Autorin bei Leserinnen und Lesern erwecken wollte): Wie geht man als Lyriker oder Lyrikerin (als schreibender Mensch überhaupt) mit Klischees und Stereotypen um, mit Allgemeinplätzen und schon sehr oft bzw. zu oft Gelesenem? Soll man es brechen, parodieren, hinterfragen, kann man das überhaupt in ein Gedicht (oder einen anderen literarischen Text) packen?
Kerstingers Bilder sind meist simpel. Ab dem ersten Gedicht kommen oft gelesene und benutzte Phrasen wie „zerplatzte die Seifenblase vom gemeinsamen Glück“ vor, ihre Sommernächste sind „lau“, die Früchte „reif“, ein Lächeln „macht sich auf die Reise“, eine Begegnung „brennt sich ins Gedächtnis“. Die Autorin spricht zwar davon, „Sprachbilder und Worthülsen“ zusammenzuklauben und sie „wie Preziosen“ sorgfältig aufzufädeln. Dabei belässt sie es auch meist, weshalb die meisten ihrer Gedichte sehr allgemein klingen, ohne die Sinnlichkeit des Details, ohne wirkliche Tiefe.
Ich sehe die Schattierungen der Grün- und Blautöne, die diesen besonderen Platz dominieren. Ich staune über das Funkeln und Glitzern, das auch dann nicht aufhört, als sich die Sonne längst hinter den dunklen Wolken versteckt hat. (…)
Selbsthilfe mit Umbruch
Vielleicht noch auffälliger ist, dass Kerstinger neben – inhaltlich passender – moderner Sprache auch immer wieder sehr veraltete Wendungen verwendet. Im Gedicht „orange the world“ ist nach der Zeile „Ich wünsche mir, keine Artikel mehr lesen zu müssen über den x-ten Femizid“ plötzlich von einem Vater die Rede, der seine Tochter „schändet“. Auch Wörter wie „Gemüt“ oder „Kleinod“ oder Phrasen wie „Im Schweiße des Angesichts“ erinnern an die Dichtung vergangener Tage und wirken veraltet zwischen dem gegenwärtigen Vokabular, das Kerstinger sonst benutzt.
Die Tiefe fehlt vielen Gedichten nicht nur sprachlich, sondern oft auch inhaltlich. Bestenfalls erinnern die Zeilen an Kalendersprüche oder Selbsthilfe-Ratschläge früherer Epochen.
Sag mir, warum es Tränen geben muss! Sie waschen die Sorgen von der Seele. Sag mir, warum Tränen nicht reichen! Wozu all der Kummer und das Leid? Weil nach Regen Sonnenschein folgt? (…) Sag mir, wie wir das ändern können! Komm, malen wir einen Regenbogen mit unseren schönsten Farben! Wir werden ihn versiegeln, damit er glänzt und nie verblasst. Er soll auch für andere strahlen, dann braucht es dafür keinen Regen und keine Tränen mehr.
Schlimmstenfalls lassen die Texte an politische Propaganda-Literatur des 20. Jahrhunderts denken:
Jugend der Welt! Nun liegt es an euch, Brücken zu bauen für ein besseres Morgen. Lasst die dunkle Vergangenheit hinter euch, aber vergesst nicht auf das Fundament, das solide, das wir mit unserer Hände Kraft erbauten im Schweiße unseres Angesichts. Vergesst nicht der Opfer, die wir dafür erbrachten. Schaufelt euch frei von Verschwörungstheorien und rechten Ideologien. (…)
Zwar merkt man der Autorin gerade im zweiten Teil „POLITISCH/FEMINISTISCHES“ die Wut an, über Ungerechtigkeit, über gesellschaftliche Zustände, über Dummheit, Sexismus und Umweltzerstörung. Dennoch erscheinen ihre Feindbilder wie Scherenschnitte, ohne Grautöne und Nuancen: die Männer am Stammtisch, die „Rechten“, die Umweltsünder.
Dass unter vielen der Gedichte auf deren vorhergehende Veröffentlichung hingewiesen wird, ist eher irritierend als hilfreich, bietet es doch beim Lesen keine zusätzliche Informationen zum Verständnis der Texte.
Poetische Kleinode
Wenn man das Buch frustriert weglegen möchte, ploppen dann (überwiegend im dritten Teil) doch immer wieder Gedichte auf, die sich von den anderen positiv unterscheiden, durch Sprachspielereien und Mehrsprachigkeit (Burgenlandkroatisch). Ein Weihnachtsgedicht, das die wahren Advent-Bedürfnisse kommerziellen Erwartungen entgegenstellt, kommt in Christbaum-Form daher. „Tupperware-Trauma“ ist eine humorvolle Plastikdosen-Suada, in „Stadtführung komprimiert“ führt ein Lyrisches Ich im breiten Dialekt durch die Freistadt Rust. Kerstingers Dialektgedichte mögen insgesamt inhaltlich nicht immer ganz neue Gedankengänge beschreiben, durch den präzise gearbeiteten burgenländischen Sound gewinnen die Texte aber Originalität und Frische.
Zwei Gedichte („Topographie einer Burgenländischen Autorin“ und „Eine Burgenländische Odyssee“) spielen voller Sprachwitz mit den Ortsnamen von Österreichs jüngstem Bundesland. „Zu viel des Guten“ experimentiert als einer der wenigen Texte mit Klischees und hinterfragt sie, „Unkonventionelle Untergrundbahn-Unterhaltung“, quasi eine Liebeserklärung an die Alliteration, ist sprachlich und inhaltlich wirklich gelungen.
(…) Ute, unternehmungslustig: U-Bahn-Wechsel? Ulrich, unterwürfig: Unter Umständen … Ute, unerschrocken: Unterirdisch? Ulrich, unangepasst: Ungünstig, unerwünscht, unmöglich! Ute, unbarmherzig: Unausweichlich! Ulrich, unheilvoll: Unerträglich! Unausdenkbar! Unfreiwillig! Ute, ungehalten: Ultrakonservativ! Unmännlich! Umdenken! Ulrich, unglücklich: Untschuldigung!
irgendwo dazwischen ist insgesamt ein Leseerlebnis zwischen Frust und Lichtblicken. Bleibt zu hoffen, dass die Autorin sich in Zukunft mehr auf ihre zweifelsfrei vorhandenen Stärken fokussiert und weggeht vom zu oft genauso Beschriebenen.
Andrea Kerstinger: irgendwo dazwischen. lex liszt, Oberwart, 2025. 172 Seiten. Euro 22,-