Udo Kawasser über Louise Glücks Gedichtband Wilde Iris
Wann geschah es das letzte Mal, dass ich immer wieder zu den ersten Gedichten eines Gedichtbandes zurückkehrte und sich dennoch stets von neuem die ursprüngliche Intensität des Leseerlebnisses einstellte? Jeder Gedichtband, vor allem wenn man die Autorin oder den Autor nicht kennt, ist ja fürs Erste eine Art „Wundertüte“, und erst im Lauf der Lektüre wird einem klar, womit man es zu tun hat und wie sehr es dem Gedruckten gelingen kann, die eigene Aufmerksamkeit zu fesseln und die Vorstellungskraft zu befeuern.
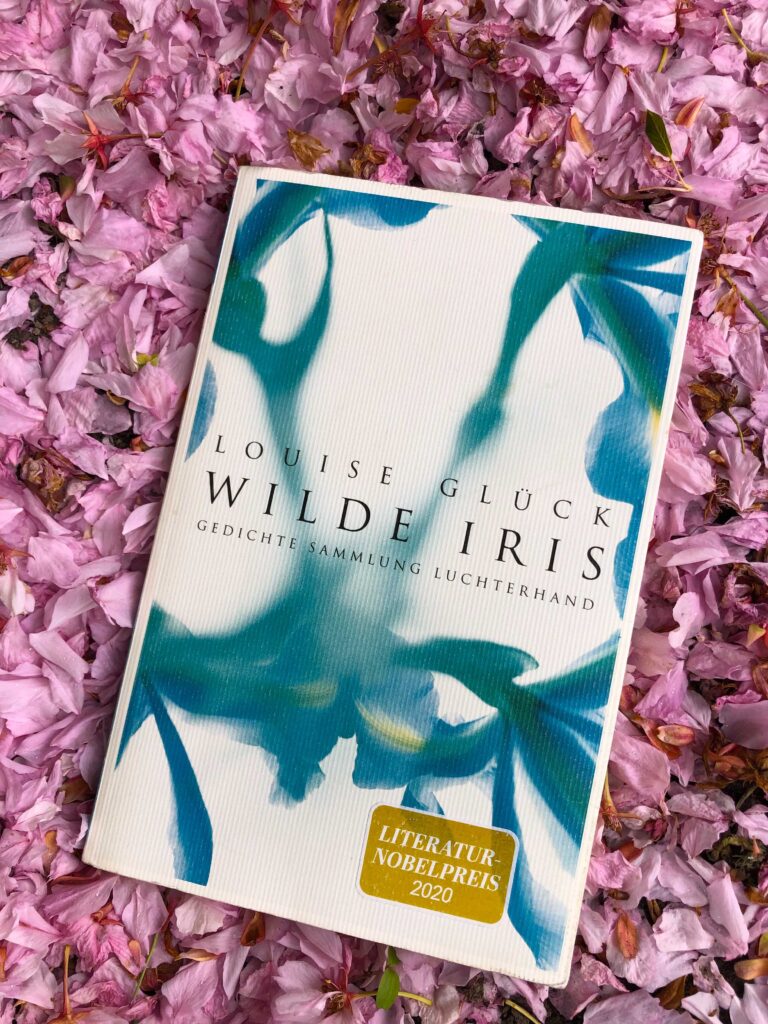
Als Louise Glück 2020 den Nobelpreis zuerkannt bekam, sagte der Name wohl den meisten Leser*innen in Europa so wenig wie mir. Ihr Gedichtband Wild Iris, der 1992 auf Englisch herausgekommen und zum ersten Mal 2008 in der Übersetzung von Ulrike Draesner in der Sammlung Luchterhand erschienen war, wurde anlässlich der Verleihung des Nobelpreises wieder aufgelegt und gelangte als Weihnachtsgeschenk in meine Hände.
Foto © Udo Kawasser
Er sollte mir eine Form von Poesie eröffnen, wie ich sie in dieser Art nicht gekannt hatte, eine Poesie, die trotz anscheinender großer Einfachheit an der Oberfläche gedanklich tief und vielschichtig gewoben ist. Dabei überrascht mich, dass mein ursprüngliches Staunen über die unterschiedlichen Sprechpositionen, von denen aus die Gedichte sprechen, noch immer anhält und sich bei jeder weiteren Lektüre noch vielfältigere Bezüge auftun. Ich möchte nun versuchen, anhand der ersten vier Gedichte dieses Staunen etwas nachvollziehbar zu machen. Das titelgebende Gedicht „Wilde Iris“, mit dem der Band anhebt, beginnt so:
At the end of my suffering there was a door. Hear me out: that which you call death I remember.
In der sich wunderbar ans Original anschmiegenden Übersetzung von Ulrike Draesner klingt das so:
Am Ende meines Leidens fand sich eine Pforte. Hört mir zu: an das, was ihr Tod nennt, erinnere ich mich.
Was war das für eine Stimme, die hier sprach? Ich vergaß fürs erste den Buch- und den Gedichttitel und glaubte eine Frau sprechen zu hören – und, als ich weiterlas, einen Anklang an den Persephone-Mythos:
Es ist furchtbar, als Bewusstsein zu überleben, begraben in der dunklen Erde.
War das Persephones Stimme, die von Hades geraubt nun als seine Gemahlin das halbe Jahr in der Unterwelt leben muss, während ihre Mutter Demeter um sie trauert? Aber ich hatte die Strophe dazwischen nicht bedacht, die das Gedicht in einer Landschaft, wahrscheinlich wie die nachfolgenden Gedichte in einem Garten, situiert:
Über mir Geräusche, schwankende Kiefernzweige. Dann nichts. Die schwache Sonne flirrte über der trockenen Fläche.
Tatsächlich wird im nachfolgenden Gedicht „Metten“, zu dessen Titel noch etwas zu sagen sein wird und von denen es verstreut im Band noch sechs weitere gibt, eine Szene im Garten entworfen, wo sich neben einer Birke ein Briefkasten befindet und ein nicht genauer bezeichneter Noah auf das Geständnis des lyrischen Ichs, „schwermütig ja, doch auf eine Art leidenschaftlich / dem lebendigen Baum zugetan“ zu sein, antwortet: „Depressive hassen den Frühling“ bzw. „es sei / ein Fehlschluss Depressiver, sich mit einem Baum / zu identifizieren“. Dieses Ich schien mir, da human, viel leichter fassbar zu sein, und schnell projizierte ich es zurück auf das erste Gedicht, „Wilde Iris“, weil es mir erlaubte, die Verse dort als Ausdruck einer depressiv gestimmten Frau zu lesen, die eine Art Wiedergeburt erlebt. Wie man hoffentlich sehen kann, beschreibe ich hier eine tastende Such- und Verstehensbewegung, die sich allerdings beim nächsten Gedicht schon wieder herausgefordert sah. Das erneut mit „Matins“, zu Deutsch „Metten“, betitelte Gedicht (es gibt später im Band auch noch neun „Vespern“) beginnt so:
Unnahbarer Vater, als wir zum ersten Mal aus dem Himmel vertrieben wurden, machtest du eine Kopie, einen Ort, der sich vom Himmel in einer Hinsicht unterschied, ersonnen, um eine Lektion zu erteilen (…)
Sprach hier nun tatsächlich jemand mit Gott? Hier, in einem zeitgenössischen Gedicht?
Wir dachten nie an dich, den anzubeten wir lernten.
Das klang dann doch nach heute und das klang mutig, sich so unversehens, aber durch eine lange jüdisch-christliche Tradition verbürgt, über die Verfasstheit der Welt mit Gott anlässlich der „Metten“ und „Vespern“ auszutauschen, und zwar auf Augenhöhe. Mit diesem ersten Gedichte-Dreischritt hatte die Autorin den westlich geprägten Kosmos ihrer Dichtung fürs Erste umrissen: die Unterwelt mit dem antiken Erbe, das gegenwärtige Leben mit Haus und Garten und die jüdisch-christlich geprägte himmlische Sphäre. Doch das nächste Gedicht „Waldlilie“ stieß mich als Leser wieder auf die Erde, in die Perspektive der Blume zurück, die aber nicht auf den Blick hinauf in den Himmel verzichten muss.
Als ich erwachte, war ich in einem Wald. Das Schwarz schien natürlich, der Himmel zwischen den Kiefern von zahllosen Lichtern übersät.
Ich blätterte zurück. Sprach also doch nicht eine Frau oder die mythologische Persephone im ersten Gedicht, sondern tatsächlich die „Wilde Iris“, eine Blume? Es blieb mir nichts anderes übrig, als das erste Gedicht nochmals mit anderen Augen zu lesen. Jede der drei Deutungsmöglichkeiten der Sprechposition (mythologisch: Persephone, gegenwärtig: depressive Frau, botanisch: Blume) tauchte den Text in ein anderes Licht und generierte spezifische Sinnkaskaden. Aber die nicht eindeutig festlegbare Sprechweise des Textes produziert einen Überschuss an Sinn, den keine dieser Möglichkeiten allein abschöpfen konnte. Wer je einen Beweis für Umberto Ecos These vom „offenen Kunstwerk“ brauchte, für den prinzipiell unabschließbaren Vorgang der Sinnkonstitution eines Textes im Rezipienten, möge es mit den erwähnten Gedichten versuchen. Ist es nicht genau das, was Dichtung in ihrer besten Form leisten kann? Nämlich zu irritieren, uns aus den überkommenen Gussformen der Wahrnehmung und des Denkens herauszubrechen und uns für neue Sehweisen und Zusammenhänge und Tiefen zu öffnen? Und in Glücks Fall (ja, im doppelten Sinne) stellt sich den Leser*innen die Frage, wer hier eigentlich spricht und woher gesprochen wird. Dieses Sprechen scheint sich immer wieder neu zu gebären. Tatsächlich heißt es in der vorletzten Strophe von „Wilde Iris“:
Euch, die ihr euch nicht erinnert an den Übergang aus der anderen Welt, sage ich, ich konnte wieder sprechen: was immer zurückkehrt aus dem Vergessen, kehrt zurück, um eine Stimme zu finden: aus der Mitte meines Lebens sprang eine hohe Fontäne, tiefblaue Schatten auf Meeresazur.
Diese „andere Welt“, sei es das „Vergessen“, das Reich des Todes, die Unterwelt, der Himmel oder eine andere Form von Transzendenz, bildet also den gedanklichen Widerpart, aus dessen Reibung mit dem Diesseits die Dichterin Glück poetische Funken schlägt. Das „Vergessen“ lässt sich hier nicht nur individuell auffassen, sondern durchaus auch auf eine präsentistische, vergangenheits- und transzendenzblinde Gesellschaft beziehen, in der durch die Dichterin Vergessenes wieder eine Stimme findet und durch deren Kunst neue anregende Gegenwart geschaffen wird. In ihrem kurzen Essay über „Death and Absence“ aus dem Band Proofs & Theories von 1994 spricht die Autorin am Ende des Textes davon, dass „Gedichte nicht als Objekte weiterbestehen, sondern als Gegenwarten. Wenn man etwas liest, das es wert ist, erinnert zu werden, dann setzt man eine menschliche Stimme frei; man entlässt wieder einen Gleichgesinnten in die Welt. Ich lese, um diese Stimme zu hören. Und ich schreibe, um mit jenen zu sprechen, die ich gehört habe.“ (Übersetzung des Verfassers)
Seit diesem Winter bin auch ich dank des Weihnachtsgeschenks einer Freundin mit Glücks Poesie im Gespräch. Blicke ich nun im April in meinen Garten, der im Moment des Schenkens vom Winter verheert war, so sehe ich „eine hohe Fontäne, tiefblaue / Schatten auf Meeresazur“.

Louise Glück: Wilde Iris. Gedichte. Übersetzt von Ulrike Draesner. Sammlung Luchterhand 2008, Euro 12,40,-
Cover © Sammlung Luchterhand




