Evelyn Bubich liest Kholoud Charafs Mit all meinen Gesichtern
Bild- und klanggewaltig sind die literarischen Mosaike, die Kholoud Charaf in ihrem Lyrik- und Erzählband Mit all meinen Gesichtern erschafft und die die Lesenden auf eine beseelte Reise in traum- und märchenhafte Landschaften schicken, in welchen die tiefe und hell leuchtende Schönheit des Lebens genauso allgegenwärtig ist wie die heimtückische, fahle Hässlichkeit des Todes. Letzterer oft so unergründlich in seinem plötzlichen, willkürlichen Auftreten.
Die Welt geht verloren
Nur ein Sternendeuter kann sie wiederfinden
denn keiner versteht
die Absicht des Todes
und seine Rätsel
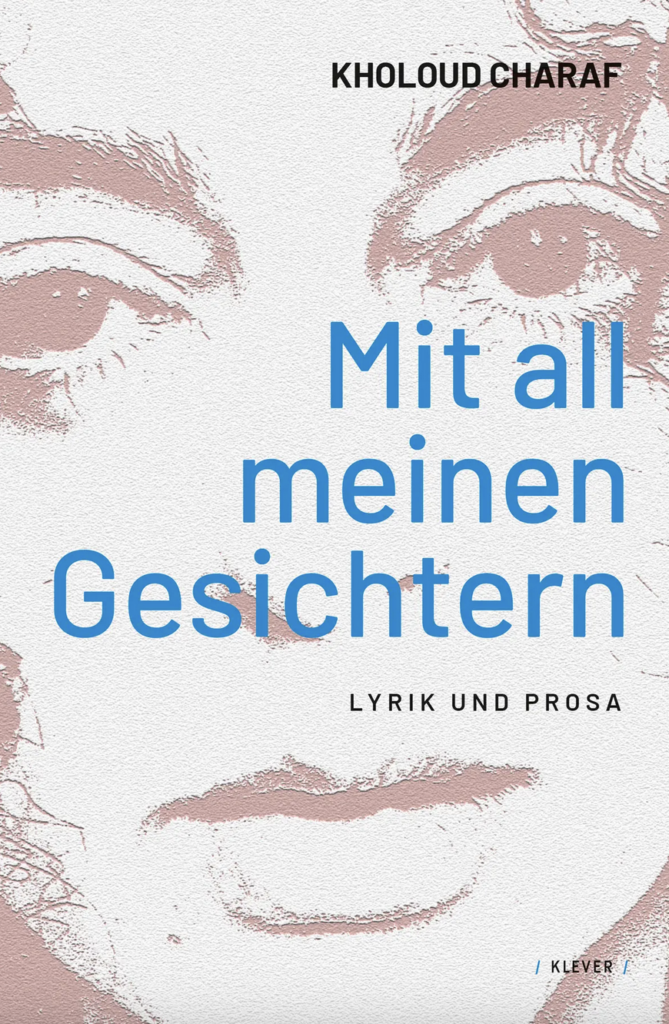
Es ist das erste – von Kerstin Wilsch aus dem Arabischen – ins Deutsche übersetzte Buch der aus dem südlichen Teil Syriens stammenden und seit 2018 an unterschiedlichen Orten (unter anderem auch in Wien) im Exil lebenden Schriftstellerin und Menschenrechtsaktivistin, deren Gedichte in über zehn Sprachen vorliegen und deren Prosabände mit Nominierungen und Preisen gewürdigt wurden.
Cover © Klever Verlag
Bausteine einer Existenz
Neben längeren, sich über fünf und mehr Buchseiten erstreckenden und sich mythologischer Bildsprache bedienenden Gedichten, in denen der Baum an einer Stelle die Elemente Himmel und Erde verbindet, sind in diesem Band auch weniger symbolisch aufgeladene Texte in Kürzestform beheimatet. So versammeln sich in der Mitte des Bandes lyrische Texte, die nur aus einer oder zwei Verszeilen bestehen.
Alles, was ich jetzt lese, macht mich mit dem Nichts vertraut Und: Parfüm ist treu, auch dann noch wenn alle längst weggegangen sind
Am Ende steht ein Dutzend Prosaminiaturen, deren sprachliches Gewebe stark verdichtet ist. Als würden die Mosaiksteinchen, die die Dichterin mit glühender Entschlossenheit aneinanderlegt, zu einem Bild komponiert werden, in dem „all meine Gesichter“ zu einer vielteiligen Einheit zusammenfinden. Bausteine, die die Existenz des lyrischen Ichs festhalten: seine Kindheit; das Zusammenleben in einem syrischen Dorf, „wo der Lehm wie Kaffee schmilzt“; die mündlich überlieferten Erzählungen der Ahnen, die aus dem Schatz einer mesopotamischen/babylonischen/arabischen Kultur, ihrer Sagen-, Götter- und Göttinnenwelt schöpfen; weibliches Erwachen; später der Krieg und die Splitter, die er in den Körpern und Seelen der Menschen zurücklässt: Traurigkeit, Verlust, Verlorenheit, Sehnen. Jedem einzelnen dieser Seelenzustände ist ein eigenes Gedicht gewidmet.
das Bausteine der Kindheit einen nach dem anderen aufsammelte – Flucht
Licht, Schatten, Licht
Es ist ein Buch, das von Übergängen erzählt, wenn sich Licht in Schatten verwandelt und Schatten in Licht. „Sobald du in die Abgeschiedenheit des Lichts eindringst / teilt es mit dir die Rituale des Schattens“. Von Leben und Tod – als „eine weitere Reise / zur Liebe?“. Von der Überlebensnotwendigkeit, die Heimat zu verlassen, in der der Krieg geduldig tobt, „bis es keine Menschen mehr gibt“. Von dem Versuch, sie mit sich zu nehmen, über Grenzen hinweg zu tragen oder sie woanders (wieder) zu finden.
Etwas zutiefst Sinnliches, universal Menschliches, nahezu Archaisches ist den Gedichten zu eigen, die allesamt vom Sein des Menschen zeugen und von dem Versuch erfüllt sind, diesem eine Bedeutung über den (eigenen) Tod hinaus zu geben, ohne es dabei manieriert zu überhöhen.
Die Reise zwischen Tod und Leben
ist unser Dasein
Mein Geliebter
wir haben keine Zeit für Krieg
Küss mich ein letztes Mal
dann werde ich beruhigt fortgehen
denn wir sind nur Besucher
Sehnsuchtsort Kindheit
„Wer bin ich“, fragt das lyrische Ich, das sich nicht gehört. „Ich gehöre mir nicht“, sagt es einmal – und begibt sich in dem gleichnamigen Gedicht auf die Suche nach sich selbst. Es irrt umher, während andere es schon immer wieder gefunden, ihm viele Namen gegeben hätten, wie es meint. Sie wüssten allerdings nicht, dass es eine Seele sei, die nach einer „fernen“ und „noch ferneren Sehnsucht“ suche, deren Erfüllung sie verdichte, wie es in einem anderen Gedicht über die Seele heißt. Charaf schreibt über die Bausteine einer Seele, in der sich die Sehnsucht mit der Erinnerung kreuzt – „Von fern dringt aus der Kindheit ein Duft herüber“ – und die langsam heranreifte seit der Kindheit, wie eine zarte Pflanze, die ihre Wurzeln und ihre Blüten entfaltet. Überhaupt nimmt die Kindheit als Ort der Sehnsucht eine federführende Rolle ein, liegt in ihr doch die Heimat, die verloren wurde und jetzt wiedergefunden werden muss, bevor der Besuch auf der Welt sich seinem Ende zuneigt.
Lange habe ich auf die Zukunft gewartet
die im Licht meines Fensters saß
Mit dem gleichen Gefühl der Einsamkeit warte ich jetzt
auf meine Kindheit
So erzählt die Miniatur „Zeit der Rückkehr“von einer physischen Rückkehr an den Ort der Kindheit, an dem sich nun die Erinnerung an das Vergangene wie ein bröckelndes, brüchiges, fast durchsichtig gewordenes Bild über die Gegenwart legt und wo das fortgegangene Ich einen Dialog führt mit dem dagebliebenen, in das das Alter gefahren ist wie in die Dinge, die es zurückgelassen hat.
Ewige Heimat
Unzweifelhaft dürfen die Texte Kholoud Charafs als intime autobiografische Zeugnisse gelesen werden, die nicht nur danach streben, sich des eigenen Daseins als Mensch zu versichern, sondern auch jenes als Frau. In dem Gedicht „Eine Gabe von Ishtar“ – im Buch lesen wir es an erster Stelle – wird das erste Begehren zur Zelebration der Weiblichkeit sowie von deren Komplexität: „(…) lässt dich feucht werden / ein Opfer nach dem es den Liebesgott verlangt“. In der Begegnung mit der Göttin Ishtar – der babylonischen Haupt- und Muttergöttin – wird man ihrer vielen Gesichtern gewahr, ist sie doch, zumindest augenscheinlich, mit höchst ambivalenten Attributen ausgestattet und wird in Verbindung gebracht mit Fruchtbarkeit, Sexualität und Liebe, aber auch mit dem Kampf, dem Krieg und der Macht. Letzteres schlägt sich im vorliegenden Band ganz besonders in der Symbolik der Natur und ihres undurchdringbaren Kreislaufs nieder.
Ich ähnele
den Überresten eines Schmetterlings
die mich an den Tod erinnern
Das lyrische Ich blickt in diesem Band, der aus der Sicht Kholouds erzählt wird – der Name bedeutet Ewigkeit, werden wir erfahren –, mit „ferner Sehnsucht“ auf die Heimat, deren Begriff durch Krieg und Diaspora droht, sich im Nebulösen aufzulösen: „Wir haben eine Heimat / doch sie ist schwer zu erklären“.
Kholoud Charaf: Mit all meinen Gesichtern. Lyrik und Prosa. Aus dem Arabischen von Kerstin Wilsch, Klever Verlag, Wien, 2024. 170 Seiten. Euro 22,–




