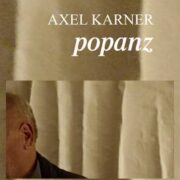Nicole Streitler-Kastberger liest Christian Steinbachers Tanz der Rollvenen
„Christian Steinbacher (geb. 1960 in Oberösterreich) kennt man als sprachspielerischen Autor, der es gerne krachen lässt“, hatte ich in der Besprechung seines Gedichtbands Dass es auch zählt: 9 Ziffern, 6 Hüte (2023) geschrieben. Dies gilt natürlich auch für seinen neuen Gedichtband, der den Titel Tanz der Rollvenen trägt; ein Titel, der durchaus erklärungsbedürftig ist. Der Autor weiß dies und stellt seinem Band deshalb eine Art Vorwort voran, in dem er erklärt, dass eine Rollvene eine spezielle Vene ist, die es mit sich bringt, „dass dann bei einer Blutabnahme oft mehrmals gestochen werden muss“, was keine sehr erfreuliche Angelegenheit sei. Und Steinbacher fügt hinzu: „(…) aber wenn sie tanzen, die Damen und Herren Gefäße, dann mag uns das durchaus zur Freude gereichen“. Soviel zum Haupttitel. Der Band trägt aber auch noch einen Untertitel, der da lautet: Umschriften auf die Trios der Scherzi in den Symphonien Anton Bruckners. Steinbachers spezieller Beitrag zum Bruckner-Jahr (200. Geburtstag 2024) also. Jeder der neun Symphonien des Komponisten ist in der Folge ein Gedicht gewidmet, wobei Steinbacher nicht Steinbacher wäre, wenn er dieses rigide System nicht auch aufsprengen würde, durch einen Anhang, der noch einmal anders geartet ist. Doch dazu später.
Sprachlust, barock
Mich hat das verrückt Delirierende der Umschriften Steinbachers an die Üppigkeit komischer barocker Literatur erinnert. Die Bezeichnung „Umschrift“ lässt vermuten, dass auch Bruckners Trios Text enthielten. Dem ist natürlich nicht so. Außerdem lässt mich das Konzept der „Umschriften“ an Arnulf Rainers „Übermalungen“ denken. Freilich malt Steinbacher mit dem Stift oder der Tastatur. Aber immerhin, er schreibt seine „Umschriften“ „nicht im Lesen etwaiger Noten, aber doch im konzentrierten Hören auf die Form der Musik“, wie er im Vorwort notiert. Es sind derbe Späße, die sich der Autor erlaubt, Spielereien mit der Sprache, wie Mozart sie in den berühmten Bäsle-Briefen betreibt. Mozart ist nicht Barock, ich weiß, man denke also vielleicht eher an Grimmelshausen oder Hans Sachs.
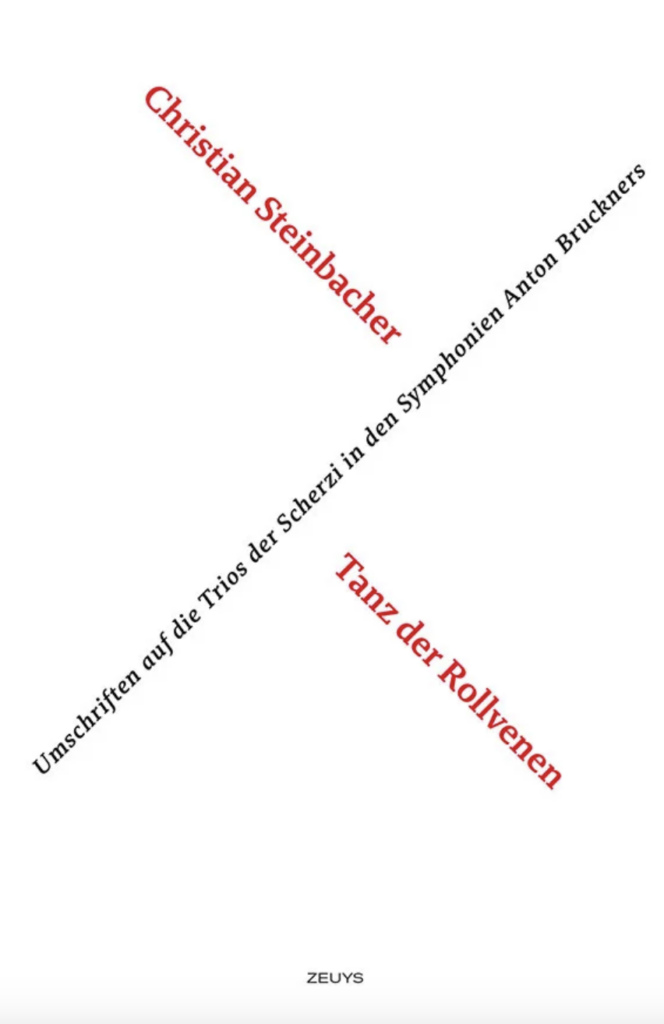
Ein „Simplicissimus“ ist dieser Steinbacher, ein Tor, der keinen Schuss auslässt, der sich ihm anbietet. Das „deftig-heftig[e] Treiben“, das er in den Trios Bruckners wahrnimmt, übersetzt er unmittelbar in deftig-heftige Verse. Eine Traditionslinie zur Nonsens-Literatur eines Morgenstern oder Ringelnatz tut sich ebenfalls auf. Doch es wird Zeit für ein Zitat. Im ersten Gedicht „Will halt sein was ich, nicht?“, das – nota bene – zur „Nullte[n]“ Symphonie Bruckners verfasst wurde, findet sich folgender Beginn:
Cover © Zeuys
Soll doch ohne Angst und Rage wahrlich gewartet mein Klöppeln sein Konterfei-Genuss unterm Klettverschluss – Sang wirkt’ gehörig verwehrt für solch Drang … ’s wär gestartet verkehrt hinterm Uranus plemplem …
Das ist Sprachspielerei in Reinkultur. Wer hier einen Sinn sucht, läuft unweigerlich fehl. Es sind sprachliche Monolithe, die Steinbacher produziert. Immer nah am Nonsens („plemplem“), aber doch auch klingend, wie der Reim von „Konterfei-Genuss“ auf „Klettverschluss“ zeigt. Ansonsten mäandert der Text reimlos von einer Seltsamkeit zur nächsten. Wie der Uranus in dieses Gedicht kommt, möge mir mal eine/r erklären!
Onomatopoesien und Anaphern
Im Gedicht „Fassungslos gar?“ zum Trio der Ersten Bruckner’schen Symphonie findet sich folgender Beginn:
Tüpfelnd legt’ das eine Linie vor dahinter oder wie auch
immer weiter weg von uns wo uns dann gleich nur wieder …
\ Ist da schon was?
\ Langt das wo hin?
Oder zieht zu der eh
Oder verhob’s den Dreh,
hob’s den, he
Das ist nicht nur onomatopoetisch (lautmalerisch), sondern auch anaphorisch mit dem gleichlautenden Beginn, der in der Folge fast überstrapaziert wird:
Schlauch und Schal umhüllen : Sei’s das schon? Ganz und gar Umwicklung : Steht das wo? Ganz und gar kein Klumpfuß : Hin und hin? Ganz und gar bloß Zargen : Doch wie was? War’s das schon? Schließt da was? Wärmt’s genug? Dass es steht? Was kommt hin? Was \ \ dann auch spärlich wüsst’s zu kicksen mit der Zeit
Das ist ein lustiges Spiel mit Anaphern, Alliterationen und Interrogationen, die doch so etwas wie eine Referenz auf die musikalische Partitur aufzuweisen scheinen.
Anagramme
Den Abschluss des Bandes bilden zwei Langgedichte mit den Titeln „Mit Rauken und Trompeten“ und „In der Blauen Gans“ sowie ein „(Anarchischer Nachschlag:)“. Die zuerst genannten Gedichte sind Anagramme auf die beiden Sätze „Anton Bruckner lachte übers abgesteckte Feld mit Rauken und Trompeten“ und „Friederike Mayröcker sitzt in der Blauen Gans und bestellt ein Gulasch“. Mit Letzterem wird einer weiteren Jahresregentin von 2024 die Reverenz erwiesen. Die Mayröcker hätte da bekanntlich ihren 100. Geburtstag gefeiert. Die 22 bzw. 31 anagrammatischen Umstellungen, die Steinbacher von den erwähnten zwei Sätzen vornimmt, sind in ihrem Kunstcharakter eindrucksvoll. Außerdem zitiert der Autor im Gedicht „Kleiner technischer Mond“ – zur Neunten Symphonie – aus Mayröckers Text „Odéon Bruckners Ödgarten“ aus dem Buch Heiligenanstalt (1978) und spannt damit eine weitere Assoziationsebene und intertextuelle Referenz auf.
Steinbachers Gedichte sind ein Augen- und Ohrenschmaus zugleich, um mich dieses barocken Ausdrucks zu bemächtigen. Sie füllen Auge und Ohr und eröffnen Assoziationsräume, die andere Gedichte erst gar nicht betreten. Man muss das nicht mögen, aber dass das avanciert und avantgardistisch ist, steht wohl außer Frage.
Christian Steinbacher: Tanz der Rollvenen. Umschriften auf die Trios der Scherzi in den Symphonien Anton Bruckners. Zeuys, Neuhofen/Ybbs, 2024. 84 Seiten. Euro 16,50