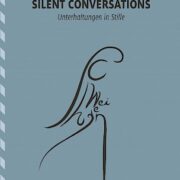Petra Ganglbauer liest Claudia Bitter. Podium Porträt 133
Claudia Bitter ist als gattungsüberschreitende Künstlerin und Autorin bekannt. Hervorragend sind ihre sprachkünstlerischen Arbeiten, in denen sie Schriftbilder aus Fundstücken aus der Natur herstellt. Aus den in diesem Band vorliegenden Gedichten spricht ein tiefgreifendes Sehnen nach Verschmelzung mit der Natur. Die Gesten von Mensch, Pflanze, Landschaft und Körper im Besonderen verleiben einander ein, um eine mystische Zusammenschau zu erwirken, die kein Außerhalb, keine Isolation des lyrischen Ichs mehr zulässt.

Letztlich handelt es sich auch um eine Sehnsucht nach einem „WIR“, das die Natur vorgibt, wie es in einem der Gedichte heißt. Denn das lyrische Ich setzt sich sehr bewusst und ohne jeglichen Filter dem Schmerz aus Einsamkeit aus. Darüber hinaus verbleibt bisweilen nur noch so etwas „wie die Erinnerung / an Sehnsucht“. Nicht einmal diese ist also eine Konstante im Leben, auch sie ist fragil und vergänglich.
zu den Vögeln der Fremde
am See kräuselt der Wind meine Lider die Sonne tunkt mir das Haar ich rieche die Bäume meine einzigen Freunde die Fische im Herz hab ich nicht gefüttert sie zappeln und fliegen wie Augen zu den Vögeln der Fremde (…)
Ein wiederkehrendes Bild, nämlich das des Halms oder Grashalms, erweist sich als tröstlich. Ein Bild, das seine Stärke letztlich auch aus seiner im Alltag wurzelnden Verwendung holt. Freilich erfährt es in Claudia Bitters Gedicht „ein Halm reicht mir die Hand“ eine weitaus größere Intensität:
meine Füße ungefüttert weinen abwechselnd ein Löffel voll Honig in meine dunklen Schritte dem Gras entgegen ein Halm reicht mir die Hand Danke, das ist gut
Doch auch das dermaßen ersehnte „WIR“ hat Blessuren, „wundgewohnt“, denn die allem und somit auch der Zweisamkeit inhärente Vergänglichkeit verstärkt das Gefühl des Alleinseins: „(…) das / Immer / ganz still“, heißt es in „Trost“.
Äußerste Bewegtheit
Die Wirkmacht dieser Lyrik speist sich aus einer steten Beweglichkeit, die selbst in kleinsten, jedoch gleichermaßen insistierenden Gesten ihre Umsetzung findet: „wohin ist dein Gesicht verzogen“. Allein die Vieldeutigkeit dieser Titelzeile öffnet den Raum für Auseinandersetzung.
Die Autorin zieht für die Verlebendigung von allem auch die Methode der Personifikation heran, bisweilen gibt es keinerlei Trennung mehr zwischen dem Ich und der natürlichen Umwelt: „mein Regen“ wird der Niederschlag in einem Gedicht genannt. Dieser „weint“, „klagt an“ oder „verzeiht nicht“. Das Ich, dessen Eigenarten so metaphorisch und zugleich mitteilsam geschildert werden, sehnt sich wiederum nach einem „Menschen / der meinen Regen mag“.
Das Faszinierende an diesem Lyrikband: Er ist metaphorisch aufgeladen und ausgestaltet. Zugleich lassen die Gedichte Raum, sich als Leser*in auf einen Tiefgang einzulassen, der durchaus zur Identifikation einlädt. So schwingen in jedem der Gedichte auch elementare Empfindungsräume mit, die uns allen geläufig sind.
Sprache und Schweigen
Immer wieder stößt das lyrische Ich an die Grenzen des Artikulierbaren, denn die menschliche Sprache ist im Gegensatz zur Sprache der Natur sehr begrenzt. Von letzterer „(…) lasse ich mir alles sagen“ heißt es in „am Morgen“. Und in „mein Name ist aus weißem Stein“ wird überdas Ich gesagt:
weiß nicht, woraus meine Stimme ist (…) aber ich weiß nicht, welche Stimme meine Wörter brauchen aber ich weiß nicht, welche Wörter meine Stimme brauchen
Auch eine explizite Körperlichkeit, Körperhaftigkeit ist den Gedichten immanent. Die Artikulationsorgane setzen sich in Szene, begeben sich tiefer in die Sprache, verleiben sie sich ein: Zunge, Kiefer und Gaumen etwa. Wörter aus Gewalt entzünden sie. Claudia Bitter analysiert zudem die Qualität der Worte genauer in dem Gedicht „gib mir dein Wort“, das in Teilen einer Apotheose gleichkommt:
glasklares Wort ein Schnitt durch die Kehle (…) sperriges Wort ein Verschlucken, Ersticken (…)
Jana Volkmann rekurriert in ihrem Vorwort zum vorliegenden Band auf Walter Benjamins Theorie der Sprache und der Übersetzung hinsichtlich einer Sprache der Dinge. Sie spricht die „Schnittstellen“ zwischen der literarischen und der bildnerischen Arbeit Claudia Bitters sowie deren Methoden und Materialien an.
Claudia Bitter gelingt mit diesem Lyrikband ein beeindruckendes Werk, das den anthropozentrischen Standpunkt in Frage stellt und das Wesenhafte der Natur auf Augenhöhe sein lässt.
Erika Kronabitter (Hg.): Claudia Bitter: Podium Porträt 133. Mit einem Vorwort Jana Volkmann. 64 Seiten. Euro 6,–