Johannes Tröndle liest Waltraud Seidlhofers stille flaneure
stille flaneure wandern ueber plaetze parcours aus den simulierten gelenken stossen ecken und enden greifen nach bechern und glas tasten tippen befehle geraeusche sind als kurven beschrieben die das gehen begleiten die kleinen gestalten auf den wegen zu schiffen und gras
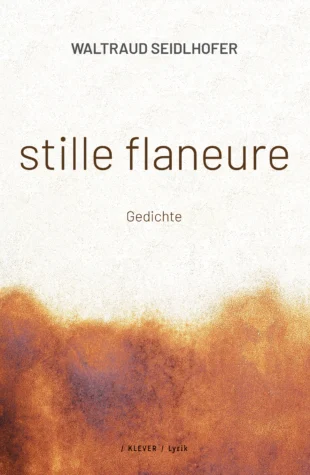
Das Titelgedicht in Waltraud Seidlhofers neuem Band ist insofern untypisch, als es die „stillen flaneure“, die „kleinen gestalten“ in ihren Gedichten ansonsten gerade nicht gibt. Keine Figuren, keine Personalpronomen, kein lyrisches Ich oder Du wandelt durch die meist knappen, kurzzeiligen Verse, die ihre eigenen, „stillen“ Räume beschreiben – und sie im Beschreiben erschaffen. Früh im Gedichtband heißt es:
Cover © Klever
an stelle von strassen wird fluss gedacht buchten und weiden biegsame formen auf denen vorueber gehend blaetter erscheinen (…)
Das Fehlen von „flaneuren“, oder überhaupt: von Akteuren, von Handelnden (bezeichnenderweise finden sich häufig Passivkonstruktionen in den Gedichten: „sind … beschrieben“, „wird … gedacht“) macht das Geheimnisvolle vieler, und das buchstäblich „Gespenstische“ des folgenden Gedichts aus:
wenig wird nachgedacht ueber die teiche die kleinen und grossen flaechen die die gegend durchziehen raine verbinden und halme die sich spiegeln zu einem wirren gespinst gespenster tauchen ueber die strassen den nachklang von wellen der die grafik des wassers im anlaut beschreibt
Poesie und Technik
Waltraud Seidlhofers poetische Landschaftsbeschreibungen sind immer klar im Ausdruck und von fast technischer Präzision. Von jeher kommen die Texte der Autorin (in aller Regel) ohne Eigennamen aus. Die Beschreibung ist unspezifisch, fiktional, doch bleibt die äußere Wirklichkeit, wie wir sie kennen, als Referent immer erkennbar. So bilden die Gedichte – jenseits aller Fantastik – eine gleichsam abstrahierte Wirklichkeit ab, eine auf ihre Grundbausteine gebrachte Welt („strassen“, „fluss“, „buchten“, „weiden“), deren „biegsame formen“ neu „gedacht“, neu erblickt werden können.
wie spiegel haften reste von realitaet an vertrauten gegenstaenden licht streift eine konturlose masse faellt ueber schemen gaerten und gruen als seien reigen automatischer figuren beharrlich am werk
Die Absenz von „flaneuren“, von „figuren“, die lediglich als „gespenst“ oder, wie eben, „automatisch“ (also unbeseelt) „am werk“ sind, verleiht vielen Gedichten einen typisch kühlen Charakter. Zudem sind „figuren“ bei Waltraud Seidlhofer oft im geometrischen Sinn gemeint („kreisfigur“) – wie überhaupt Geometrie, Geografie und bildende Kunst als Bezugssysteme ständig präsent sind. „leinwand“, „palette“, „striche“, „geraden“, „kreise“, „ellipsen“, „grundriss“ wären weitere Beispiele für das verwendete Vokabular, und der gleichsam unpersönliche Blick von oben auf eine Welt, die wie ein Plan oder Modell erscheint, nimmt Maß, so scheint es, am Blick etwa einer Architektin, Stadtplanerin oder technischen Zeichnerin. Weiters kommen Distanzierungs- und Verfremdungsmittel zum Einsatz: Neben den schon erwähnten Passivkonstruktionen etwa die oftmalige Verwendung des Konjunktivs. Auch auf der typografischen Ebene gehen die Texte ihren eigenen Weg: mit konsequenter Kleinschreibung, Verzicht auf Interpunktion sowie Vermeidung von Umlauten, die stattdessen mit den jeweils entsprechenden zwei Buchstaben (ae statt ä) transkribiert werden.
Leichtigkeit und Utopie
Doch freilich erschöpfen sich die Texte nicht in ihrem technizistischen Gestus. Poetisch sind Waltraud Seidlhofers Gedichte nicht nur, weil Sprache in ihnen nach ästhetischen Prinzipien geformt ist, sondern weil sie jenseits blicken lassen: hinter die objektivierbare Welt oder über diese hinaus. Das Denken im Konjunktiv, in der Möglichkeitsform, birgt utopisches Potenzial:
waere die welt so zu beschreiben : dass die linien anders verliefen fuer diesen auftritt die szene das spiel
In manchen wie zeitlos schwebenden, in sich ruhenden Gedichten scheint eine Utopie bereits verwirklicht – oder auf dem Papier verwirklicht, Sprache geworden. Der Beginn des folgenden Gedichts zeigt die Richtung an:
manchmal sollten sich woerter leichter reihen zu helleren bildern zu dattelhainen und buchen
Sprachliche Schönheit und Leichtigkeit sind Merkmale vieler Gedichte des Bandes. Dazu eine besondere Form von Zurücknahme, eine Stille, die schon im Titel liegt. Es sind angenehm unaufdringliche „flaneure“, die, flexibel im Geist, nicht viel benötigen, um die Welt zu betrachten und neu zu formen: Luft – und gelegentlich auch etwas Wärme.
zwischen buechern und bildern werden atemzuege probiert noch gibt es luft woerter zu fuellen und der raum wird als mantel um die schultern gelegt
Waltraud Seidlhofer: stille flaneure. Gedichte. Klever, Wien, 2025. 108 Seiten. Euro 20,–




