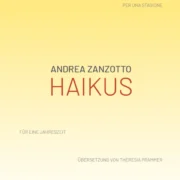Johannes Tröndle liest Eva Maria Leuenbergers die spinne
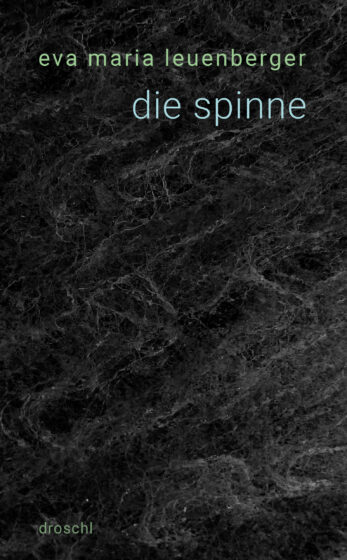
Der „anfang“ in Eva Maria Leuenbergers dystopischem Langgedicht ist der Anfang vom Ende:
hier ist der anfang, flügchen. die zahlen prasseln auf deinen kopf in stunden, sonnensekunden. die feuer rollen in endlosschleifen über dich hinweg.
die spinne ist der dritte Band der viel beachteten Schweizer Lyrikerin, die im Literaturverlag Droschl veröffentlicht. Tod, Zerfall, Vergänglichkeit, aber auch Formen von Auflehnung und Widerstand sind in allen drei Bänden Thema. So im Debüt Dekarnation (2019), in dem Natur und menschlicher Körper auf zahllose Weisen ineinander übergehen, poetisch beschrieben etwa anhand zweier Moorleichen und ihrer komplexen, gegenläufigen Prozesse von Auflösung und Konservierung. kyung (2021) wiederum setzte der feministischen, koreanisch-US-amerikanischen Avantgardekünstlerin Theresa Hak Kyung Cha ein Denkmal, die im Alter von 31 Jahren Opfer eines Femizids wurde.
Zerstörerische Vorgänge
die spinne schließt nun (auch optisch, in der grau-schwarzen Cover-Gestaltung) an Leuenbergers Debüt an, wobei die Natur hier zuallererst von einer umfassenden Zerstörung geprägt ist.
wie du dich klammerst an die alten bilder: den kastanienbaum vor deinem fenster, noch ohne feuer
Es hat ein Zeitenwechsel stattgefunden und die „neuen bilder“ sind ausgetrocknete Bäche, Regenwasser, das nicht mehr trinkbar ist, „brennende zweige, fallendes eis“, in der Hitze „gerbende frösche, deren sprache / unter den steinen klemmt“.
Das lyrische Du, das „flügchen“, ist in den Gedichten durchgehend präsent – ein rätselhaftes Wesen, insektenhaft, doch mit menschlichen Zügen, das zurückgezogen, apathisch „hinter geschlossenen gardinen“ auf einer Matratze liegt, nur selten aufsteht, eine Zigarette raucht oder vielleicht auch längst schon („hast dich glattgemacht, zu pixel / und glas“) in einer digitalen Parallel- oder Ersatzwelt verschwunden ist. Das „flügellose flügchen“ erscheint wie die personifizierte Hilflosigkeit, die den zerstörerischen Vorgängen rundum nichts (mehr) entgegenzusetzen weiß. Wesentlich zur Lähmung der Figur trägt bei, dass sie sich nicht allein im Raum befindet:
eine spinne webt ihr netz an der decke über dir; sie ist groß, und alt, und vielleicht beinahe schwarz.
Die titelgebende Spinne repräsentiert „eine alte schuld / in der geschichte“ – das Versäumnis, der Klimakatastrophe nicht rechtzeitig gegengesteuert zu haben, ließe sich interpretieren. Die Spinne ist ständig da, beobachtet das „flügchen“, wartet, lauert. Die spannungsgeladene Konstellation – wie zwei, die sich gegenseitig in Schach halten – wird noch verstärkt dadurch, dass unklar bleibt, wer hier überhaupt spricht bzw. das „flügchen“ anspricht. Eine übergeordnete Instanz, wesenlos, doch immer wie am Sprung, in das Geschehen einzugreifen. Mantraartig wiederholte Formeln (etwa „wie immer“; „wie erwartet“ oder „so ist es“) wirken anfangs wie zynische Kommentare aus dem Off, werden dann jedoch dringlicher, fordernder: „mach doch, flügchen“. Indes scheint bereits der Anblick der Spinne oder das von ihr Angeblicktwerden paralysierend, denn:
der blick sticht das gift in die haut, den mund, die schenkel, die innersten gruben.
Suspense und Stille
Aus den zeitlich aufeinanderfolgenden Kapiteln des Langgedichts lässt sich ein Plot destillieren, der auf eine Klimax zusteuert und gegen Ende einen Neubeginn setzt. Dass dabei tatsächlich so etwas wie Suspense entsteht, ist ein für einen Gedichtband durchaus ungewöhnlicher Effekt. Bemerkenswert ist „die spinne“ aber vor allem in ihrer kunstvollen Sprach- und Formgebung. Alle drei Bände Eva Maria Leuenbergers sind – in Wortschatz wie Länge – von einem stark reduktionistischen Ansatz geprägt: wenige Worte, sparsam über die Seite verteilt. Wichtiges Strukturelement ist zudem die Wiederholung: wiederkehrende Verse oder Wortgruppen (wie oben beschrieben), die den Text rhythmisieren. Es sind Gedichte zum Vorlesen, zum Laut-Lesen, die im akustischen Raum ihre musikalischen Qualitäten entfalten (hier vergleichbar etwa dem sprachmusikalischen Werk von John Cage). Gerade in ihrer Zurückgenommenheit, der fast asketischen Konzentration auf ihre immer wieder neu variierten lyrischen Bausteine, gewinnen die Gedichte ihre Kraft.
In ihrer visuellen Gestalt können die Texte dabei ganz verschieden gesetzt sein: links-, rechtsbündig oder mittig, teils auch im Blocksatz. Immer wieder finden sich einzelne Verszeilen eingerückt, oder es bleibt innerhalb einer Verszeile eine Leerstelle – wie überhaupt die Buchseiten sehr vielWeißraum aufweisen, denn die einzelnen Gedichte, so vielgestaltig sie sind, umfassen meist nicht mehr als ein Dutzend kurzer Zeilen. Dass die fünf Kapitel samt Coda im Band ein zusammenhängendes Langgedicht bilden, erschließt sich somit weniger grafisch als inhaltlich, erst beim Lesen. Anstelle eines durchgehenden Versflusses wird dieser ständig durchbrochen, von Leere – oder von Stille durchschossen: einer angespannten Stille, zwischen den Zeilen so greifbar, dass man „die spinne“ zu hören meint, wie sie oben an der Decke ihr Netz webt. Oder ein leises Kratzen auf Papier vernimmt, an einer Stelle (nicht dem Ende des Langgedichts), an der das „flügchen“ mit der Dichter:in zu verschmelzen scheint – einer Stelle, die zwar nicht unbedingt Hoffnung, doch immerhin Durchhaltevermögen verspricht:
flügchen: du weißt, dass das blut unter deinen fingernägeln klebt; an den rücken der bilder, die du unter deinem bett versteckst. weißt, dass kein regen mehr trinkbar ist, nirgendwo, an keinem ort. dass kein gedicht das wasser reinigt, kein wort den durst noch löscht. und trotzdem kratzt du deine zeichen ins papier, egal, wie viele bäume darin verenden.
Eva Maria Leuenberger: die spinne. Literaturverlag Droschl, Graz, 2024. 96 Seiten. Euro 21,–